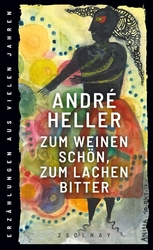Doch gerade einmal zwei Buchseiten weiter wird aus diesem leicht märchenhaften Auftakt eine surrealistisch-magische Etüde. Farouk sinniert über sich und die Menschen, über Glück, Unglück, Erinnerung und das Warten – das Warten, in dem er versinkt und aufhört, seine Gebetsformeln und Litaneien zu rezitieren. Er versinkt, wartend, in der Betrachtung eines Kobrabeschwörers, der fünf Meter entfernt sitzt. Und dann realisiert Farouk, dass sich seine Seele von seinem Körper abzuspalten beginnt, dass sich sein Körper Teil für Teil auflöst, um ganz zu zerspringen. Schließlich ist Farouk ein Nichts, ein allerletztes vergehendes Hallen am Grunde eines Brunnens.
Dies ist eine der vielen kurzen Geschichten, die André Heller, wohl einer der letzten rundum neugierigen und immer wieder Neues ausprobierenden Universalkünstler (vom Wiener Lied bis zur Gartenarchitektur, vom Varieté zum Rundfunk zur Malerei), nun in seinem Erzählband „Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ versammelt hat.
Die 47 nicht chronologisch geordneten Texte entstanden zwischen 1969 und 2003 und sind, wie ein knapper Nachweis am Ende informiert, zum Teil früheren Bänden wie „Die Ernte der Schlaflosigkeit in Wien“ (1975), „Café Hawelka“ (1982), „Schlamassel“ (1993) und „Als ich ein Hund war“ (2001) entnommen, die in unterschiedlichen Verlagshäusern erschienen sind. Nicht die Majorität, aber bemerkenswert viele Texte stammen aus den 1990er Jahren und haben Marrakesch zum Hintergrund, dessen Atmosphäre und Flair und Andersartigkeit.
Zum anderen ist auch das eigene Leben, ist Autobiografisches immer wieder ein Bezugspunkt – der Vater, die Mutter, die Familie, die Stadt Wien. Der erste Text handelt von der Milchfrau namens Begovich, die so weiße Haare hat, „als hätte sie sich in einem unachtsamen Augenblick eine Portion Schlagobers auf den Kopf gepatzt.“ Schon in diesem Text, einem der frühesten, entstanden im Jahr 1969 – da war Heller gerade einmal 22 Jahre alt, gleitet das Erzählen aus den realen Bahnen und wird zur andersweltlichen Außer-Wiener Extra-Magie. Der Milchladen ähnelt im Inneren einem Kinderzimmer, einem ins Große gezogenen Kinderkaufmannsladen, und die zwei Damen Begovich – die Schwester der Milchfrau leidet an Elefantiasis und kann auf einer Hand 23 Nusskipfel servieren – träumen von anderen Kontinenten, sie sparen für eine Reise zum Kilimandscharo und nehmen Unterricht, um Kisuaheli zu lernen: „damit die Wüden uns net für Wüde halten, und damits merken, dass a Weaner a a Hirn hat.“ Sonntags, am einzigen arbeitsfreien Tag der Woche, spazieren die beiden in Spitzenkleidern wie brüchige Engel durch die Alleen und füttern Tauben mit Semmelbröseln.
Si non è vero, è bon trovato. Wenn nicht wahr, so doch glänzend erfunden. Und so finden sich in Hellers Erzählungen aus fünf Jahrzehnten zahllose Glanzstücke. Man muss sagen: Als Autor ist er gnadenlos unterschätzt. Vielleicht ist das Schreiben auch überdeckt von seinen vielen anderen sprudelnden Talenten. Da gibt es surreale Begegnungen in einem fast leeren Wien – einmal folgt er einem Mann, den er nur von hinten sieht, der geschlagen und emotional geprügelt aussieht, aus reiner Neugierde läuft er dieser merkwürdigen Erscheinung nach, umspinnt diese Gestalt mit Gedanken, Assoziationen und Gespinsten. Bis der Mann sich umdreht – und es ist: Kurt Waldheim. Wien und den Wienern widmet er mit „Die Ernte der Schlaflosigkeit in Wien“ ein unerbittliches Portrait von eleganter Schärfe.
Eine Besonderheit machen jene Erzählungen aus, in denen Heller durch eine andere Persona hindurchspricht und diese Protagonisten sich unmittelbar über ihr Leben beugen lässt, so etwa in „Die Frau in der Tür zum Park“: „Ich will es nicht mehr haben. Es macht kaputt.“ Raffinierte Lamenti in eigener Sache sind dies, Rollenprosasprechstücke eines Lebens, das sich selbst verfehlt, ozeanische Wortwogen über Gefühle, die hin- und herschwanken, Figuren, die hier zu schwach sind, dort zu phlegmatisch, an anderer Stelle von erschreckend normaler Mutlosigkeit. Kurz: kunstvolle, ergreifende Beichten, die berühren, weil sie in ihrem Elend so realistisch und so direkt dem Leben entnommen sind.
„Auch wenn manche Ehe im Himmel geschlossen wird, so bleibt als unerbittliche Tatsache, dass man sie auf Erden leben muss.“ Für solche Auftaktsätze würden schreibende Kollegen vieles geben. Heller fließen solche aphoristischen Schnappschüsse leicht aufs Papier. überaus abwechslungsreich gestaltet er seine Geschichten, die recht klein daherkommen und doch vom Großen handeln – „Vom wirklichen Leben“ heißt beispielsweise ein Text aus dem Jahr 1976, „Ein Ort der selbstverständlichen Täuschungen“ ein anderer. Eine der beeindruckendsten Geschichten ist „Dem Himmler sein Narr“ von 1992, der Monolog eines obdachlosen Juden in New York, dem Heller zufällig begegnet, und der 40 Jahre zuvor ein Konzentrationslager nur deshalb überlebte, weil er als „Narr“, entsprungen einem mittelalterlichen Hofe, von der SS gehalten wurde für den Fall, dass Heinrich Himmler ein zweites Mal im Lager auftauchte. Dieser beklemmende, irritierende Text sollte seinen Weg in Schul-Lesebücher finden.
Natürlich tauchen in Hellers Prosa seine Lebensmotive auf, die später zu überaus erfolgreichen Aktivitäten abseits der Literatur führten, Clowns zum Beispiel oder eine Marionettenbühne. Im Lauf der Entstehungszeit gewinnen die Erzählungen an Internationalität, spielen in Nordafrika und New York, Paris wird erwähnt, Korfu und Lissabon, der Shiv-Niwas-Palast im indischen Udaipur. Kunstvollerweise – oder ein sinniger Fehler des Korrektorats? – fehlt beim allerletzten Text dann die ansonsten sorgsam notierte Jahresangabe. Heller erzählt so ins Offene hinein, in die Zukunft.
Es zeugt von großer Souveränität, den Philosophen und Autor Franz Schuh ein essayistisch mäanderndes langes Nachwort beisteuern zu lassen, ist dieser doch alles andere als ein „Hellerianer“, vielmehr ein kritischer Beobachter über fast vier Jahrzehnte hinweg in derselben Stadt, in Wien. Auch Schuh, bekanntlich ein hochbelesener Rezensent, kann sich jedoch dem erzählerischen Sog nicht entziehen und erliegt der üppigen Imagination und der sprachlichen Virtuosität von André Hellers Prosa.