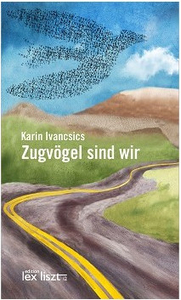Zugvögel sind wir ist eine Sammlung von insgesamt 15 Texten, von denen manche bereits andernorts erschienen sind und die sich irgendwo im Spannungsfeld zwischen kürzeren Fragmenten und längeren Notizen, philosophischen Erörterungen und politischen Pamphleten, kleineren Skizzen und ausgewachsen(er)en Erzählungen bewegen. Ebenso vielfältig nehmen sich die behandelten Themen aus: Die Bandbreite reicht von der Frage, wie man den von Bedürftigen gesäumten Schulweg des Sohnes am besten zurücklegt, ohne diesen mit dem in mehrerlei Hinsicht dargebotenen Leid zu überfordern, bis hin zu Spekulationen über Josef von Eichendorffs berühmten Taugenichts, wäre dieser vor 100 Jahren im Burgenland auf Achse gewesen.
Ungeachtet dieses Spektrums an unterschiedlichen Stoffen und Sujets lassen sich jedoch gewisse rote Fäden ausmachen, die in einem großen Teil der Texte auf die eine oder andere Art und Weise zu finden sind. Dazu zählen unter anderem Reisen im weitesten Sinn, erzwungene Migration ebenso wie freiwilliger Urlaub – wobei ersteres wesentlich mehr Raum einnimmt als letzteres. Nicht selten werden diese beiden Aspekte gegenübergestellt, wie etwa in „Aus der Ferne“: Zur selben Zeit, in der die Ich-Erzählerin in Übersee weilt, sind Tausende Flüchtende auf den Straßen ihrer Heimat unterwegs. In „Sich drehen wie ein Derwisch“ wiederum, dem mit 17 Seiten längsten Text des Bandes, werden während eines Aufenthalts auf der Insel Sansibar Gespräche mit der längst verstorbenen arabischen Prinzessin Sayyida Salme imaginiert, die der Liebe zu einem deutschen Kaufmann wegen ihre eigene Heimat verließ und fortan als Emily Ruete in der Heimat ihres Mannes lebte.
Dass dem Thema Migration und Flucht eine solch prominente Rolle zukommt, hat nicht allein mit der Tatsache zu tun, dass es in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren nocheinmal verstärkt an Bedeutung gewonnen hat. Nein, es handle sich dabei auch, so Ivancsics in der Nachbemerkung zu ihrer Prosasammlung, um einen Teil ihrer „Familienbiografie“. Dementsprechend werden nicht zuletzt Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Heimat, Zugehörigkeit und Identität diskutiert: „Ist es deshalb wichtig und klug“, liest man etwa an einer Stelle, „sich auf eine Heimat, eine Region zu besinnen und sich mit anderen Gleichgesinnten zusammen zu tun, um eine gewisse Sicherheit gegen all diese verwirrenden Spielarten von Spiegelungen aufzubauen? Was bestimmt eine Region und deren Zugehörigkeiten? Religion? Hautfarbe? Geschlecht? Sprache?“
Ein zweiter prominenter Strang ist die Situation von Frauen, mit der sich die Autorin ebenfalls seit Erscheinen ihres ersten Buches 1989 kontinuierlich auseinandersetze, wie sie in ihrer Nachbemerkung schreibt. Mit am eindrücklichsten gelingt dies in „Auf ein Wort“, einem von mehreren sogenannten Monologen im Band, in dem ein Sprecher gegenüber einer Adressatin mit gleichermaßen zweifelhaften wie entlarvenden Scheinargumenten einen nicht näher definierten Vorfall herunterzuspielen versucht: „Nein, nenne es nicht Scheinheiligkeit, eine Familie muss zusammenhalten, was innerhalb der eigenen vier Wände passiert, geht niemanden außerhalb etwas an, du solltest in Betracht ziehen, dass es um weit mehr als dein persönliches Wohlbefinden und deine Vorstellung von Gerechtigkeit oder Genugtuung geht.“
In Texten wie diesem zeigt sich Ivancsics‘ ganzes Können: Sie ist eine Meisterin der kleinen Form, eine überaus genaue Beobachterin, die ein Gespür für Details, aber gleichzeitig die Fähigkeit besitzt, zum jeweiligen Kern der Dinge vorzudringen und diesen mit wenigen Worten in meist nur kurzen Szenen zu umreißen. Und das Ergebnis ist immer ein Destillat, das mit vielen verschiedenen Geschmacksnoten aufwartet, die es als Leser:in zu entdecken gilt. Oder, um es mit Katharina Tiwald, deren Nachwort sich am Ende des Bandes findet, zu sagen: Ivancsics „verpackt das Gehörte in Monologe, die in ihrer Genauigkeit und Zielgerichtetheit alles sind: säuberlich Dokumentiertes, aus Schnipseln Verdichtetes, Abbild unserer Zeit – und Anklageschrift, Letzteres verschleiert und deutlich zugleich.“
In diesem Zitat klingt auch jener Punkt an, in dem sich Zugvögel sind wir vermutlich am deutlichsten von „Aufzeichnungen einer Blumendiebin“ unterscheidet: und zwar in der Direktheit, mit der bestimmte Probleme hier verhandelt werden. War der Blick der Blumendiebin noch vornehmlich ein nach innen gerichteter, geht es nun mehr um den Blick nach außen, auf die Welt und alles, was diese in den vergangenen Jahren bewegt oder, wie im Falle der Coronapandemie, zum kurzzeitigen Stillstand gebracht hat. Insofern ist „Zugvögel sind wir“ weniger poetisch als politisch, doch der leichte, luftige, mitunter verspielte Ton, der „Aufzeichnungen einer Blumendiebin“ so lesenswert macht, ist auch in Ivancsics‘ neuem Band anzutreffen – und auch hier wieder ein absoluter Pluspunkt.