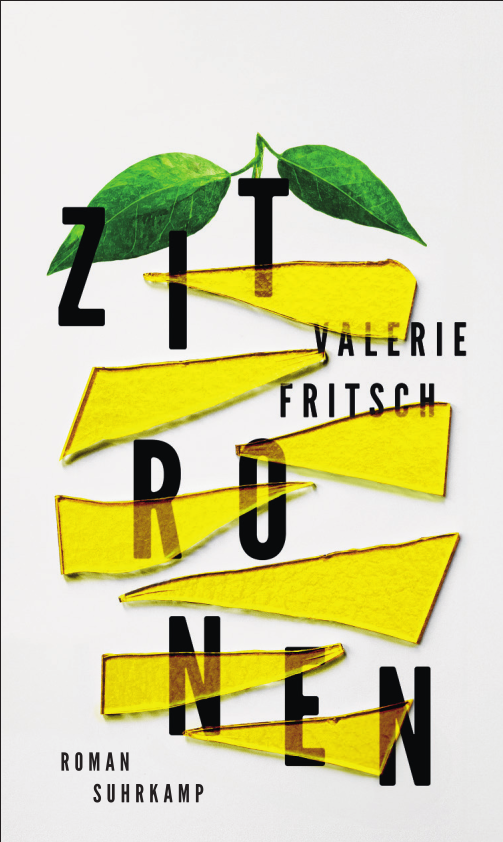Jahrelang hatten das Tier und die Menschen friedlich zusammengelebt, doch eines Tages hatte der Bär das Paar getötet. „Wieder und wieder überlegte er [der Vater des Protagonisten, Anm.] laut, was die Unregelmäßigkeit seines Wesens, was die Ausnahme seines Verhaltens gewesen war: alle Tage davor oder jener eine des Angriffs.“ (S. 36) Spätestens an dieser Stelle lässt sich erahnen, dass es auch mit den Figuren des Romans kein gutes Ende nehmen wird.
„[O]b die Gewohnheit oder die Abweichung bestimmte, wer man war“ (S. 36) – diese Frage zieht sich in unterschiedlichen Varianten immer wieder durch Fritschs neuen Roman. Gegliedert in zwei Teile erfahren wir die Geschichte von August, der in einem kleinen Dorf aufwächst. Der alkoholkranke und gewalttätige Vater verlässt eines Tages die Familie, und August bleibt alleine mit der offenbar unter Depressionen leidenden Mutter zurück. Einfühlsam schildert Fritsch die Traurigkeit der Mutter, die den ganzen Tag fernsieht und sich von ihrem Leben mehr erhofft hatte, „eine von der Welt Überrumpelte, eine wirre Prinzessin, ewig ungekrönt“ (S. 20). Obwohl sie kaum aus dem Haus geht, kleidet und schminkt sie sich stets mit größter Sorgfalt, doch so wie in allen anderen Bereichen gehen ihre Ambitionen und ihre Mühen ins Leere, da kaum jemand sie je zu Gesicht bekommt.
Gefangen in ihrem Schmerz fällt es der Mutter schwer, Nähe zu ihrem Sohn herzustellen, Umarmungen scheinen unmöglich, als gäbe es „keine Tötungs-, aber eine Zärtlichkeitshemmung“ (S. 44). Erst als August einmal von einem hartnäckigen Husten befallen wird, erwacht die ehemalige Krankenpflegerin aus ihrer Lethargie und entdeckt eine fatale Lösung: Sie schafft es, ihre Liebe in Form von Fürsorge zu kanalisieren. Die neue Aufgabe und das Ansehen, das sie dadurch in der Außenwelt des Dorfes und der Arztpraxen genießt, lassen sie so sehr aufblühen, dass sie bald nicht mehr darauf verzichten will und schließlich zu drastischen Maßnahmen greift, um eine Genesung ihres Sohnes dauerhaft zu verhindern.
Ein wenig erinnert sie an die großen Hochstapler-Figuren der Weltliteratur – etwa Highsmiths Tom Ripley –, wenn sie mit erstaunlichem Ehrgeiz und fehlgeleitetem Talent beginnt, Arztunterschriften, Stempel, Diagnosen und Rezepte zu fälschen. Präzise und akkurat schildert Fritsch, wie die Mutter die Symptomatik des sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndroms entwickelt, eine psychische Erkrankung, die nicht zuletzt vor einigen Jahren durch den auch als Serie verfilmten Roman Sharp Objects (2006) von Gillian Flynn einer größeren Öffentlichkeit bekannt wurde. Während sich Flynn mit ihrem Thriller eher an ein jugendliches Publikum richtet, hebt Fritsch das Thema nun auf eine höhere literarische Ebene.
Obgleich es sich bei Zitronen definitiv um keinen Feel Good-Roman handelt, ist zumindest jener erste Teil über Augusts Kindheit von einer großen Sinnlichkeit erfüllt, die eine gewisse Versöhnung mit der Welt erlaubt. Die Apfelbäume im Garten der Mutter, die Speisen, die unterschiedlichen Schauplätze des Dorflebens, der Urlaub in Italien, der zumindest für einige Wochen so etwas wie eine Erlösung verspricht – all dies wird so farbenprächtig geschildert, dass man am liebsten Zeile für Zeile ganz langsam lesen möchte, um jedes Detail voll auskosten zu können. Diese überwältigende Ästhetik wird jedoch im zweiten Teil scharf beschnitten, wenn wir den erwachsenen August in seiner lieblos eingerichteten Wohnung und im chaotischen Atelier seiner Freundin erleben. Während er sich als Barkeeper durchschlägt und die Nacht zum Tag macht, verbringt er seine Zeit mit Menschen, die durch ihre Lebensumstände zu Außenseitern wurden und überwiegend von Schmerz und Pessimismus erfüllt sind. Obgleich dies in der Logik der Erzählung durchaus Sinn ergibt, wirkt die zweite Hälfte des Romans dadurch allzu düster und trostlos, das Schicksal allzu ausweglos.
Viele kleine Details machen Zitronen zu einem Lesegenuss, etwa dass die Freundin des erwachsenen August den Schriftzug „EWIGER SOMMER“ als Tätowierung trägt eine charmante Referenz auf den Vornamen des Protagonisten ebenso wie auf die vorübergehende Zeit der Leichtigkeit und Hoffnung, die August bei dem bereits erwähnten Italienurlaub in der Kindheit erfuhr. Zahlreiche, wie nebenbei eingestreute Formulierungen beeindrucken mit der Klarheit und Weisheit, die aus ihnen spricht, etwa wenn die rohe Gewalt des Vaters mit der versteckten, subtileren Gewalt der Mutter verglichen wird: „Dem Vater fiel er in die Hände, der Mutter in die weit ausgebreiteten Arme.“ (S. 28) Trotz der Brisanz des Themas findet Fritsch für ihre Erzählung eine wohltuend unaufgeregte, fast nüchterne Sprache, die an keiner Stelle in Effekthascherei oder gar Moralisierung abgleitet. Jedoch – und dies ist der einzige Kritikpunkt – zeigt die Autorin einen Hang zu apodiktischen Aussagen, von denen manchmal fraglich ist, ob sie wirklich haltbar sind: „Jede neue Stadt wird erst in jenem Augenblick, in dem man einen anderen Menschen in ihrem Inneren liebt, zu einem Zuhause.“ (S. 116) An diesen Stellen stolpert man und fragt sich, ob sich so etwas wirklich in dieser Allgemeingültigkeit sagen lässt.
Valerie Fritsch greift in Zitronen ein wichtiges, kontroverses Thema auf. Durch ihre präzise, sinnliche und zugleich ökonomische Erzählweise verleiht sie komplexen Fragestellungen eine ansprechende ästhetische Form und lässt ausreichend Leerstellen, um Leser:innen zum Nachdenken und Diskutieren anzuregen. Fritsch gelingt es, dass die Figuren und deren Schicksale auch lange nach der Lektüre in Gedanken nachklingen.
Daniela Chana, geb. 1985 in Wien, promovierte an der Universität Wien im Fach Vergleichende Literaturwissenschaft. Ihr Gedichtband Sagt die Dame (Limbus Verlag), wurde 2019 unter die Lyrik-Empfehlungen der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung gewählt. 2021 folgte, wieder bei Limbus, der Erzählband Neun seltsame Frauen, der Chana eine Nominierung auf der Shortlist des Österreichischen Buchpreises eintrug. Für die Tageszeitung Die Presse schreibt sie regelmäßig Essays über Themen des Alltags und der Literatur.