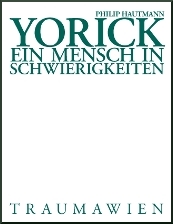Yorick, so beginnt es immer wieder, sei ein witziger Kerl, etwas dick, gutmütig und leutselig bzw. ziemlich aufdringlich, der immer dann daherkommt, wenn man ihn nicht eingeladen hat und den man auch nicht loswird, verlässt man die eigene Wohnung etwa. Nachdem man Yorick in seiner wiederkehrenden Art kennengelernt hat, sind die Freunde dran, die Feinde – die Gesellschaft; und zu dieser gehören auch die Milliardäre, einen von ihnen (Mearsheimer) lernt Yorick näher kennen: Im Zuge einer kurzfristigen Anstellung in einer Unternehmensberatung, deren Ziel es ist, Yoricks bankrotten finanziellen Zustand zu verändern, das Problem allerdings, dass der angestellte Yorick „immer die Wahrheit sagt“ (so der Autor), wenn von ihm Einschätzungen zu Religion und Neoliberalismus gefragt sind. So kommt Yorick zwar zu Schriften (wenngleich nicht zu dem großen Roman), verliert allerdings die Stelle innerhalb kürzester Zeit wieder, gewinnt dann Zutritt zum Club der Milliardäre, die Yoricks Auslassungen durchwegs begeistert aufnehmen, da sie ihnen entgegenkommen. Mearsheimer und Yorick werden nun Gesprächspartner, was bedeutet, dass der Milliardär monologisiert (Freitod, Kindheit, die Zukunft der Welt usw. usf.), Yorick in die Rolle des Zuhörers verwiesen und beim ersten Stichwort wieder fallen gelassen wird. Teil eins kommt als Künstler- und Intellektuellen-Roman daher, Teil zwei besteht vor allem aus den Exposés Yoricks und den Betrachtungen Mearsheimers (und ist exemplarisch für die Aggressivität der Kursivierung), im dritten Teil wird der Text zu einem Entwicklungsroman der Psychologin Sabine, einer Freundin Yoricks, deren Familien- und Fallgeschichten, und zu den ersten Versuchen, den großen Roman zu schreiben, als der sich „Yorick“ letzten Endes herausstellt.
Das Land, in dem Hautmann Lewis Carrols Alice wähnt – das Wunderland der Kindheit –, wird im dritten Teil (in dem die Teile eins und zwei teilweise wieder aufgenommen werden) mehr und mehr zu einem Land der Wunderkinder (Sabine und deren Geschwister) als Garanten für eine schwierige Erwachsenenexistenz.
Der Roman schert sich nicht um Widersprüche (das permanente Kreisen um sich selbst wird der Forderung nach Achtsamkeit für andere gegenübergestellt) und ist in seiner Ausführlichkeit äußerst konsequent. „Yorick“ ist gleichzeitig Karikatur auf den Künstler- und Intellektuellenroman und Parforce-Ritt durch die Weltliteratur. An einer Stelle beschreibt Yorick den Roman, den er nach acht Jahren denn doch geschrieben zu haben scheint, in einem Schreiben an „die zwei größten und renommiertesten Verlage seines Sprachraums:“
„(…) Mit all dem gebotenen Respekt vor der Tradition Ihres ehrwürdigen Verlagshauses übermittle ich Ihnen folgenden Yorick-Roman. Er umfasst gut achthundert Seiten Papier sowie ein kompliziert angelegtes Inhaltsverzeichnis. Schnell werden Sie bemerken, dass die Angelegenheit herkömmlicher Erzählstrategien sich verweigert sowie herkömmlicher Muster und Versuchen der literarischen Deutung und Hermeneutik sich entzieht.“
Nun ist Yorick im Trauma Verlag Wien erschienen – als Hybridroman. Die Bezeichnung bezieht sich auf Icons, die auf einzelnen Seiten unterhalb der Paginierung angebracht sind und die etwas machen, wenn man seinen Computer oder sein Handy darauf hält (man bekommt Einblick in die Bibliothek des Autors und dergleichen) – und nicht, wie die Rezensentin annahm, weil der Text im besten Sinne übermütig und anmaßend ist, zügellos und ein sich austobender. Witzig und größenwahnsinnig breitet sich der Roman aus ohne dabei auszufransen. Klein ist er nur an jenen Stellen, an denen der (ehemalige) Finanzminister in persona (einmal sogar in Funktion eines Verlegers) auftaucht. Mit Bernhard könnte man fragen, ob Yorick ein philosophischer Mensch ist oder ein Philosoph. Über Hautmann kann man sagen, dass es ihm nicht um den Menschen geht und auch nicht um Philosophie allein, sondern um die Welt anhand der Figur des Yorick, der ein Hofnarr bleibt, in diesem Fall aber sehr lebendig.