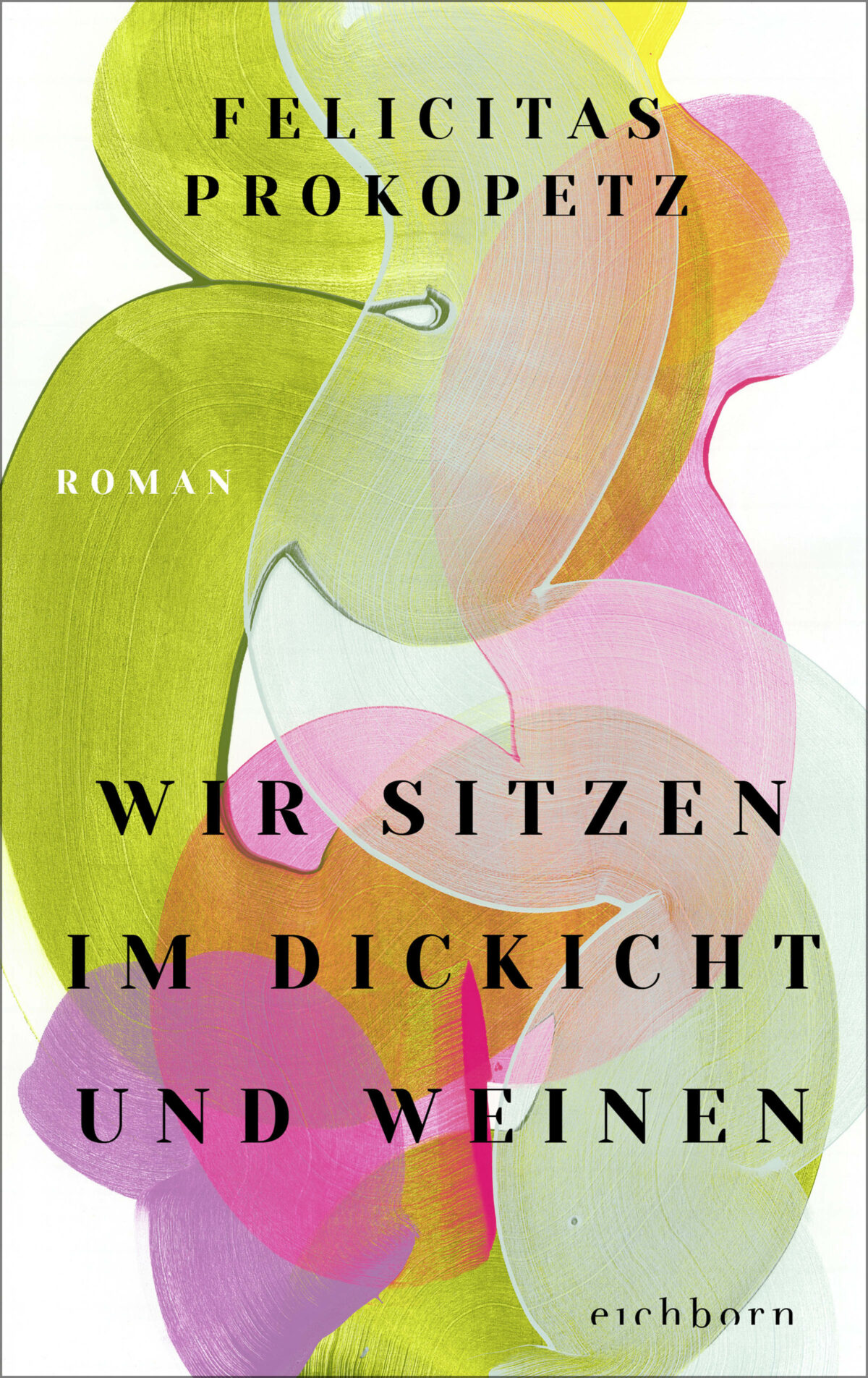Nun also Felicitas Prokopetz‘ Debütroman Wir sitzen im Dickicht und weinen, in dessen Zentrum die Journalistin Valerie steht, die gerade sowohl als Mutter wie auch als Tochter herausgefordert ist. Bei Valeries Mutter Christina ist nämlich Krebs diagnostiziert worden, was bei beiden Frauen tiefe Ängste auslöst. Ihr Verhältnis ist ohnehin bis zum Zerreißen gespannt und wird nur durch ein genau austariertes Nähe-Distanz-Verhältnis einigermaßen im Zaum gehalten – der Romantitel ist ein Zitat aus dem Buch und weist auf das komplizierte Verhältnis zwischen Mutter und Tochter hin.
Doch auch Sohn Tobi macht Valerie Probleme. Der pubertierende Junge, dem seine allzeit besorgte alleinerziehende Mutter noch immer alles hinterherräumt, ja, dessen Atem sie nachts heimlich kontrolliert, möchte gern ein Schuljahr in Großbritannien verbringen. Ein Schock für Helikopter-Mutter Valerie. Über zwölf Zeilen ergießt sich im Text der Katarakt ihrer mütterlichen Sorgen und Horrorvorstellungen, mündend in den Satz „Ein Fremder steht in der Tür und teilt mir mit, dass meinem Sohn etwas zugestoßen ist.“ Valerie scheinen die Felle davon zu schwimmen. Ihr graut vor einem „Leben, in dem ich mich als mütterliche Erschafferin abgeschafft haben werde“.
Dann wird die Familiengeschichte noch komplexer, durch einen Sprung zurück ins Jahr 1934, zu Valeries Großmutter Martha, die damals noch ein Kind ist. Die brave und begabte Martha versteht sich ausgezeichnet mit ihrem Vater, wird jedoch von ihrer Mutter abgelehnt. Martha denkt, „weil alles Warme von der Mueti für den Vati ist, und sie, Martha, nichts davon haben darf“. Noch mal 15 Jahre früher kehrt der Vater von Charlotte, Valeries anderer Großmutter, als menschliches Wrack aus dem Ersten Weltkrieg zurück. Spürbar konkurriert er mit den Kindern um die Zuneigung und Aufmerksamkeit der Mutter. Charlotte und ihr Bruder werden systematisch von ihr ferngehalten und müssen stattdessen Benimmregeln lernen.
Schnell wird klar, dass Ehen und Verwandtschaftsbeziehungen in diesem Roman äußerst ambivalent besetzt sind. Das gilt für die Zeit vor 60, 70 Jahren schon deshalb, weil es damals noch keine chemische Geburtenkontrolle gab und man schon deshalb heiraten musste, weil es zum klassischen Lebensmuster gehörte und es für Frauen im Grunde kaum Alternativen gab. Martha, Valeries Großmutter, fühlte sich von ihren Kindern jedenfalls hoffnungslos überfordert und wollte ihre Familie am liebsten verlassen. „Die kleine Christina an ihrer wunden Brust trinken zu lassen und die körperliche Nähe zu ihr waren Martha unerträglich.“
Valeries andere Großmutter, Charlotte, bekommt von ihrem Mann das zeitübliche „Haushaltsgeld“ in die Hand gedrückt. Darüber hinaus schuftet sie für einen Hungerlohn als Buchhalterin. Damit ihr Sohn versorgt ist, muss sie (in einem Zeitalter vor der Tiefkühlpizza) in aller Herrgottsfrühe aufstehen, um Palatschinken oder Frittatensuppe zuzubereiten. Charlotte fragt sich ängstlich, ob sie ihrem Ehemann widersprechen darf. Erst als Großmutter kann sie, von der täglichen Sorgearbeit befreit, die Nähe ihrer kleinen Enkelin Valerie genießen. Die Männer ihrer Generation tragen im Roman die Züge von Haustyrannen.
Ein Blick in die Geschichte zeigt, wie das möglich war. Erst seit 1975 dürfen österreichische Frauen ohne Erlaubnis ihres Ehemanns arbeiten gehen. Interessanterweise war Österreich bei den Frauenrechten teilweise schneller als Deutschland. In der BRD musste der Mann der Berufstätigkeit der Ehefrau noch bis 1977 zustimmen. Die Vergewaltigung in der Ehe wurde in Österreich ab 1989 strafbar. In Deutschland gibt es diesen Straftatbestand seit 1997. In der Schweiz, wo einige Szenen des Romans spielen, wurde das Frauenwahlrecht erst 1971 – durch eine Volksabstimmung der Männer – eingeführt. In Deutschland und in Österreich existiert das Frauenwahlrecht – immerhin – bereits seit 1918.
Zurück zum Roman: Valeries Mutter Christina magert im Krankenhaus immer mehr ab, wirft ihrer sich kümmernden Tochter jedoch – wie immer – vor, lieblos zu sein. Man erfährt im Rückblick, dass auch die kleine Valerie bei aller Liebe für ihre Mutter eine Last ist, wenn diese auch hoffte, dass die Tochter eines Tages stolz auf ihre „studierte“, berufstätige Mutter sein würde. Valerie hingegen hadert damit, dass sie als Kind von der alleinerziehenden Mutter vernachlässigt wurde. Es ist typisch für die Konstellationen in diesem Roman, dass die konträren Gefühlswelten der Protagonistinnen oft verborgen – quasi „im Dickicht“ – bleiben. Christina genest schließlich vom Krebs, ihre Gesundung wird allerdings von einem Riesenkrach mit Valerie begleitet.
Erzählt wird ausschließlich aus der Perspektive von Frauen. Männer bleiben eine große Leerstelle. Es gehört zu den raffiniertesten Aspekten dieses geschickt arrangierten Buchs, dass sich darin kapitelweise immer wieder Nachrufe auf Valeries Vater Roman finden – der sicherlich nicht zufällig „Roman“, also wie eine Fiktion, heißt. Fantasiert Valerie seinen Tod bloß? Roman ist ebenso „abwesend“ wie der Vater von Tobi. Als Schockmoment wirkt daher eine drastische Passage, in der Valerie über ihren kranken Vaters plötzlich als Pflegefall spricht, den sie im Bett angebunden und geknebelt hat und foltert. Als er „eines Morgens“ tot daliegt, heißt es lakonisch: „Er war friedlich eingeschlafen.“ Eine weibliche Rachevorstellung, in der symbolisch das Patriarchat exekutiert wird?
Felicitas Prokopetz‘ Debütroman ist souverän gemacht und psychologisch schonungslos. Fast schon systematisch untersucht die Autorin die Möglichkeiten und Entscheidungen verschiedener Generationen von Frauen. Die Zwänge, noch in der Großmuttergeneration, gehorsam zu sein und sich zu fügen. Die Selbstverständlichkeit, mit der Sorge- und Hausarbeit von Frauen von der Gesellschaft in Anspruch genommen und nicht honoriert wird. Die Ambivalenzen des Mutter- wie des Tochterseins. Die Ungerechtigkeit von Gefühlen, die Mütter ein bestimmtes Kind bevorzugen lassen. Mit Valerie und Christina, deren Berufstätigkeit konsequent ausgeblendet wird, porträtiert der Roman auch zwei Generationen von Alleinerziehenden und die daraus resultierende Überlastung der Kinder, die drohen, zu Ersatzpartnern ihrer Eltern zu werden. Kann man daraus folgern, dass matrilineare Storys die Rollenzuschreibungen von Frauen infrage stellen? Nicht zwangsläufig, aber in diesem Fall schon.
Judith Leister lebt in München. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften in München und Berlin ist sie heute als freie Journalistin vor allem für die Neue Zürcher Zeitung und den Deutschlandfunk tätig.