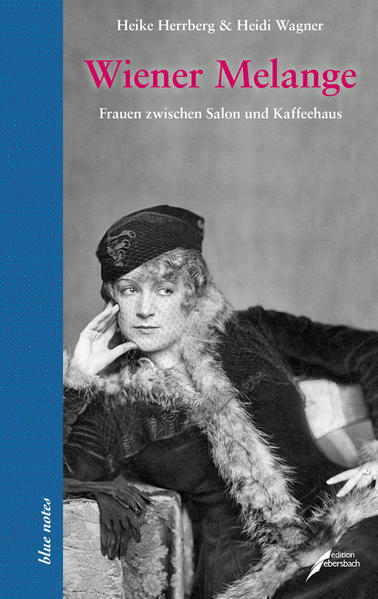Doch was machte die andere Hälfte? Wer jetzt noch nachdenken muß, dem sei ein kräftiger Schluck Wiener Melange nachdrücklich empfohlen: Heike Herrberg und Heidi Wagner haben diese Kulturgeschichte der Frauen in den 20er und 30er Jahren nachgezeichnet. Nach „Die Wilden Jahre in Berlin“, „Paris war eine Frau“ und „Crazy New York“ nun also ein ebenso auf- wie anregendes Buch der Edition Ebersbach über (nun aber wirklich!) „Tout Vienne“. Beeindruckend in der Aufmachung, sorgfältig recherchiert, ausgestattet mit vielen, wunderschönen Fotos und in einem so stimulierenden wie schnörkellosen Ton geschrieben, wird die Spurensuche der Autorinnen zur kurzweiligen Lektüre und zugleich zu einer herrlichen Verführung, sich ins vergangene Jahrhundert aufzumachen.
Wem also mittlerweile nicht mindestens ein Dutzend weiblicher Namen eingefallen sind, der blättere die ‚andere‘ Geschichte dieser Stadt auf: die Geschichte ihrer Menschen, ihrer Orte, ihrer kosmopolitischen Szenerie einmal aus Frauenperspektive und nicht als Aperçu zur Männerwelt (ein Schicksal, das unter anderem Anna Freud beschieden war, die – zunächst unermüdliches Mädchen für alles bei ihrem Vater – sich dank ihrer Lebensgefährtin Dorothy Burlingham von dessen Autorität lösen und ihren selbständigen Beitrag zur Entwicklung der Psychologie leisten konnte).
Denn natürlich gab es sie, die epochemachenden weiblichen Persönlichkeiten, die Pionierinnen, die Avantgarde des Femmes, die Stars. Nur – in unser Bewußtsein scheint dies nicht immer ausreichend gedrungen zu sein: Lou Andreas-Salomé, Anna Freud, Hilde Spiel oder Alma Mahler-Werfel, ach ja! Doch es waren viel, viel mehr. All diese Frauen, sie agierten nicht nur als Partnerinnen, geheime Mitschreiberinnen, Lebensgefährtinnen und exzentrische oder exotische Glanzstücke des öffentlichen Lebens; sie schrieben ihre eigenständige, andere Seite der Kulturgeschichte. Sie kultivierten – nicht weniger als die Männer – ein Netzwerk gegenseitiger Bekanntschaften und Freundschaften; denn Kenntnisnahme, Solidarität und Unterstützung brauchte frau, wollte sie in der immer noch patriarchalischen Männerwirtschaft ihren Platz finden.
Überleben in dieser Männerwelt, das hieß erst einmal Geld verdienen. Nicht leicht, wenn man als Frau kaum eine fundierte Ausbildung genoß (Ausnahmen bildeten die Jüdinnen, die deshalb einen beträchtlichen Anteil an der Emanzipation hatten. Umso schmerzlicher die Einsicht, was auch hier, auf dem Gebiet weiblicher Kultur, die Nazis zerstörten). Überleben hieß aber auch, sich gegen die männliche Vereinnahmung und Funktionalisierung zur Wehr setzen. Wie selbst die vermeintlich progressiven, intellektuellen Männer sich weiterhin die ‚Frau an ihrer Seite‘ dachten, beschrieb Lina Loos, Gattin des berühmten Architekten, in ihrem Theaterstück „Wie man wird, was man ist“: „Ich“, verkündet dort der Protagonist seiner Geliebten, „Ich werde sie formen, ich werde Gutes herausholen, Schlechtes brach liegen lassen. Es soll ein Kunstwerk werden“. Kunst gab es schon, aber nicht die gewünschte: nämlich non-(männer)-konforme.
Die Zeit für Experimente und Ausbruchsversuche war günstig: Sorgte nicht nur in Berlin, sondern auch in Wien Josephine Bakers Bananenröckchen für Skandal, so zeigt sich schnell, daß nicht nur sie Tabus brach. Es war chic, Moral und Konventionen hinter sich zu lassen. Frauen gingen alleine aus, wählten ihre Partner nach eigenen Vorstellungen und tauschten die Korsetts gegen das Reformkleid – in jeder Hinsicht. Daß das ohne gehöriges Gefühlschaos, ohne Eifersucht nicht abging, daß berufliche Konstellationen und Freundschaften wechselten und die finanzielle Lage oft äußerst prekär war, das änderte nichts an der Aufbruchstimmung und an dem Willen, etwas Neues zu versuchen. Vor allem in der Kunst und in der Liebe, wo die Frauen die männliche Bevormundung satt hatten und sich nicht selten – beruflich und privat – dem gleichen Geschlecht zuwandten.
Die Cafés waren dabei die Zentren der Ideenschmiede und bildeten neben den Salons – die traditionsgemäß von Frauen betrieben wurden – die Orte der Begegnungen und der Kommunikation. Die Bühne, die Presse, die Mode – sie ermöglichten weibliche Eigenständigkeit. An den Universitäten dagegen spielten Frauen (sofern sie überhaupt zugelassen wurden) nur eine exotische Außenseiterrolle. Eugenia Schwarzwald, die tatkräftige Reformpädagogin, mußte zu ihrem Germanistik-Studium, das sie 1894 aufnahm, noch in die Schweiz umsiedeln. Von dort schrieb sie mit gehöriger Selbstironie, aber auch unmißverständlich auf ihren Anspruch auf Leistung beharrend: „Um hier [d.h. in Zürich] zu studieren, mußte man einen Knax haben. Vorher fing man nicht an. Man kam zum Studium aus unglücklicher Liebe, aus Weltschmerz, oder, das war das Schlimmste, aus Grundsatz. Jedes Mädchen, welches mit Mühen und Not die Matura gemacht hatte, war nämlich ein Pionier. Lauter Brünhilden. Jeder Ausspruch trug Harnisch…“ Später machte sich ‚Fraudoktor‘ für gemischte Klassen stark und sorgte mit unkonventionellen Lehrmethoden für Wirbel. Genias gastfreundlicher, zwangloser Salon in der Josephstädter Straße war Treffpunkt zahlreicher Künstler und Intellektueller aus ganz Europa. Vor ihrer Emigration 1938 in die Schweiz gründete sie ein Lehrmädchenwohnheim und unterstützte ihre Schülerinnen (darunter Hilde Spiel und Helene Weigel) nach Kräften.
Und was war da noch? Frauen, deren intellektuelle Leistung verschwiegen wurde, wie die Schriftstellerin Veza Canetti (ihr Mann hielt ihren Anteil an dem Buch „Masse und Macht“ für ebenso groß wie seinen eigenen, erwähnte aber in seiner Autobiographie die literarische Arbeit seiner Frau mit keinem Wort); Frauen, die ihre Kunst revolutionierten wie die Tänzerinnen Hilde Holger, Grete Wiesenthal, Gertrud Kraus und Gertrud Bodenwieser. Es gab großartige Interpretinnen wie die Sängerin Maria Jeritza (die vor allem Richard Strauß‘ skandalträchtigen Opern zur Anerkennung verhalf) und ihre Antipodin Lotte Lehmann. Es gab Journalistinnen und Kritikerinnen wie Ea von Alesch (die ‚Königin‘ der Kaffees und der Mode) oder Gina Kaus, Gründerin der Zeitschrift „Die Mutter“. Es gab die Fotographin Dora Kallmus, die unter dem Namen Madame d’Ora Karriere machte, und ihre ehemalige Mitarbeiterin Trude Fleischmann, die vor allem durch Porträts und Aktaufnahmen brillierte. Es gab politisch engagierte Zeitgenossinnen wie Ida Roland (die zusammen mit ihrem Mann Graf Richard Coudenhove-Calergi für die paneuropäische Bewegung kämpfte) und Milena Jesenská. Letztere war nicht nur die verschwenderische, so bodenständige wie introvertierte Tochter eines reichen Prager Chirurgieprofessors und zeitweise Briefpartnerin Franz Kafkas, sondern Zeitungskorrespondentin und entschlossene Kämpferin gegen den Faschismus. 1944 kam sie im Frauen-KZ Ravensbrück ums Leben. Zu den Vertreterinnen des ‚Roten Wien‘ gehörten nicht zuletzt auch Frauen aus großbürgerlichen Kreisen. Zunächst eher den progressiv-liberalen Strömungen zugeneigt, agierten sie vor allem in den 30er Jahren dezidierter im Widerstand als ihre männlichen Kollegen (und sie betrieben, wenn es sein mußte, beherzter und weitsichtiger die Emigration). Wie breit der Aktionsspielraum „zwischen Salon und Kaffeehaus“ sein konnte, das verkörperte vor allem die Grande Dame und Kopf der Wiener Intelligenz, Berta Zuckerkandl, Hofrätin, Journalistin, Übersetzerin und Muse, die ihren Salon in der Oppolzergasse – jour fixe am Sonntagnachmittag, inmitten eines vom Stararchitekten der Wiener Werkstätten, Joseph Hoffmann, eingerichteten Ambientes – für politisch und künstlerisch aufgeschlossene Kreise öffnete.
Wenn sich auch die Lebenslinien nach dem Zweiten Weltkrieg verliefen, viele Frauen auf der Flucht umkamen, in der Emigration scheiterten, einfach vergessen wurden oder, wie Ea von Alesch 1953, vereinsamt und krank im Lainzer Armenspital der Stadt Wien starben, eines zeigt sie doch, diese Kulturgeschichte über und von Frauen: kein Grund zur Bescheidenheit! Bei der nächsten Tasse Gold werden wir uns daran erinnern.