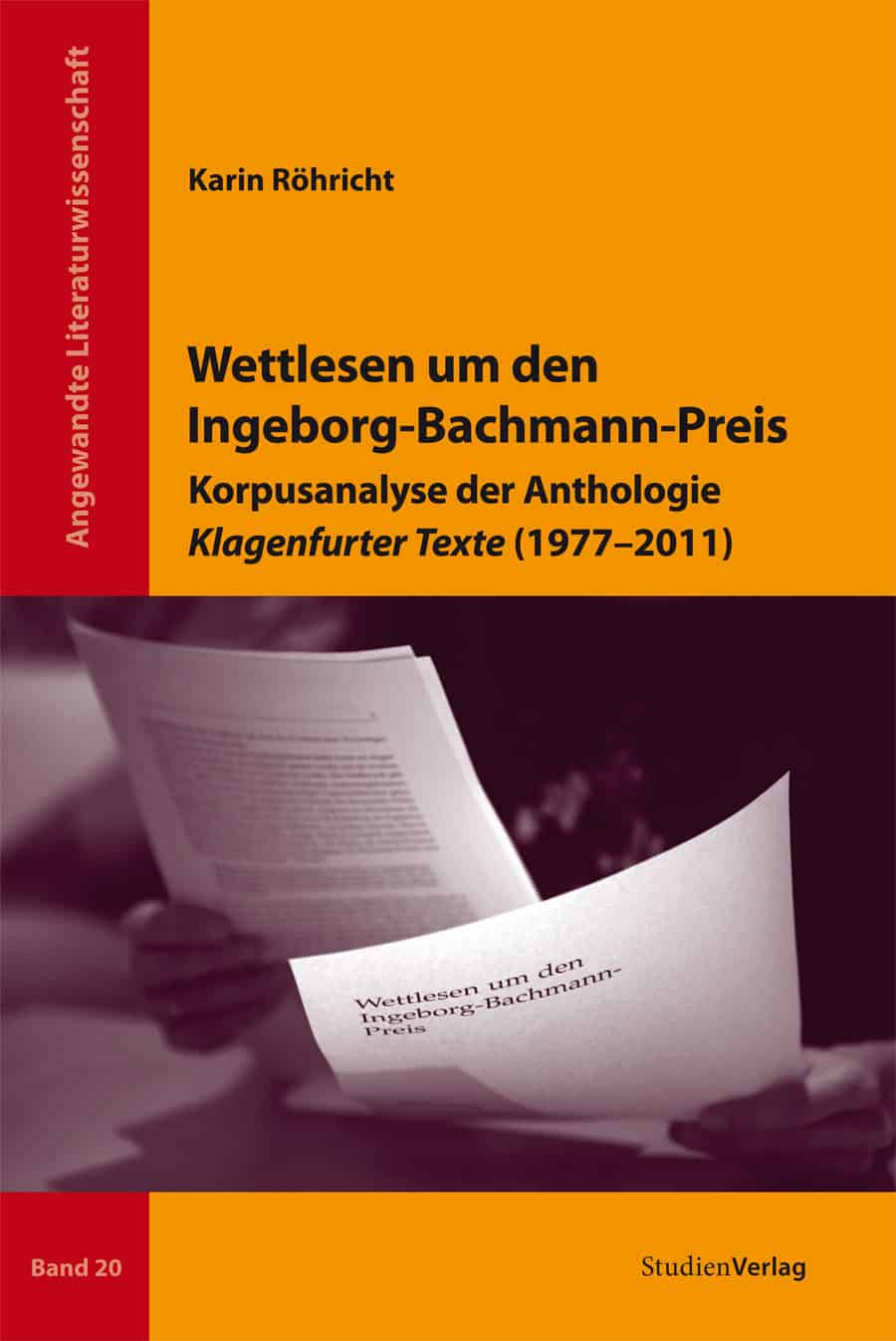Die Untersuchung ist eingebettet in eine Analyse des Kontextes: Der Bachmann-Preis – wie auch der junge Deutsche Buchpreis – werden am Anfang der Karriere verliehen und können für den Werdegang der Ausgezeichneten, in etwas abgeschwächter Form auch für jenen der anderen TeilnehmerInnen, von entscheidender Bedeutung sein. Besonders ist das Preisgeschehen Klagenfurt vor allem durch seinen ritualisierten und medial inszenierten Ablauf, dessen Grundzüge weitgehend konstant geblieben sind. Die größte Irritation ist denn im Verlauf der Geschichte nicht von Texten ausgegangen – sieht man von künstlichen Erregungen wie 1991 über Urs Allemanns Babyficker-Text ab –, sondern von der Durchbrechung des vorgesehenen Rituals. Etwa als Sten Nadolny das Preisgeld 1980 auf alle TeilnehmerInnen aufteilte und damit die Grundfeste des „Wettlesens“ aushebelte, bei dem es wie in der Sportarena eben nur einen Sieger geben kann.
Zum Ritual des Ablaufs gehört auch das Schweigen der AutorInnen zur Debatte der Jury, eine Erwiderung ist „nicht nur unüblich“, sondern wird „schnell als nicht souveräne Haltung abqualifiziert“ (S. 59). Das könnte man als einen der skurrilsten Aspekte des Literaturbetriebs der Nachkriegszeit interpretieren. Übernommen wurde er aus den von Hans Werner Richter gesetzten Vorschriften der Gruppe 47, deren Akteure allesamt im autoritären System des Nationalsozialismus sozialisiert wurden. Obwohl die Treffen der Gruppe 47 als Arbeitstagungen gedacht waren, wurde ein zentrales Element dafür, die Diskussion über die Texte mit jenen, die sie verfasst haben, von vornherein ausgeschlossen, demokratische Strukturen und die dazugehörige Debattenkultur hatten die Beteiligten nicht gelernt und wollten sie auch nach 1945 nicht zulassen. Genau dieses aus einem autoritären System stammende Faktum hat sich bis heute in Klagenfurt erhalten, es ist weniger „asketisch“ (S. 299), denn antidemokratisch. So viel auch über die Rolle der jeweiligen Jury, über die Sinnhaftigkeit des Verfahrens und des Ablaufs im Lauf der Jahrzehnte gehandelt und gehadert wurde, in seiner politischen Problematik wurde das grundlegende Faktum nie debattiert.
Das ist auch in der vorliegenden Arbeit nicht anders, deren Hauptteil freilich die „inhaltsanalytische Korpusuntersuchung“ der Anthologien zum Bachmann-Preis ist. Inhaltsanalyse meint dabei, alle Texte nach einem vorab entwickelten Schema abzuklopfen, also an jeden einzelnen Text dieselben Fragen zu stellen. Das setzt eine Reduktion voraus, um verallgemeinerbare Aussagen über den gesamten Korpus zu bekommen. Die Schlüsselrolle spielt dabei natürlich das zugrunde gelegte Fragen-Schema (S. 87f.), das zwangsweise erkenntnislenkend wirkt.
Als Kontinuität lassen sich dieser Analyse zufolge etwa zwei Drittel der Texte sechs Themen zuordnen, fünf davon sind „privater Natur“: „Familien, Schicksalsschläge, intime Beziehungen, Arbeit, Alltag“ (S. 97), das sechste Thema fällt in den Bereich Zeitgeschichte. Solche Aussagen enthalten problematische Vorentscheidungen, wenn etwa das Thema Arbeit ohne Bedenken dem „privaten“ Sektor zugeschlagen wird, so wie generell vielleicht die größte Problematik des angewandten Analyseinstrumentariums die fehlende Zugriffsmöglichkeit auf Fragen der gesellschaftspolitischen Relevanz der einzelnen Themen ist. Schwierig ist auch die Entscheidung, wann ein Text Sprachkonventionen bricht. Dass nur 1986 und 1995 mit Katja Lange-Müller bzw. Jan Peter Bremer Texte ausgezeichnet wurden, die „sich dem konventionellen Sprachgebrauch widersetzen“ (S. 94), übersieht zumindest den Preisträger von 1977, Gert Jonke, dessen Text im Kapitel „Privater Alltag“, Unterkapitel „Sonderbare Charaktere“ abgehandelt wird (S. 169f.). Außenseiter und Sonderlinge sind in der Literatur freilich häufig gesellschaftspolitische Spiegelfiguren, die entgegen dem vordergründigen Setting ,privater Rückzugsraum‘ in die Verfasstheit der Gesellschaft direkt und bewusst ausgreifen.
Dass viele der Texte konkrete Handlungsräume ausgestalten und mit geringem Personal befüllen, ist ein Charakteristikum der Klagenfurt-Texte – besonders zahlreich waren „klar begrenzte Räume und seltene Ortswechsel“ (S. 202) zwischen 2000 und 2010 –, das dem Setting geschuldet ist: In 30 Minuten Lesezeit sind komplexe Handlungsverläufe schwer unterzubringen. Topografisch gibt es „keine Region oder Stadt, die besonders häufig vorkäme und die Texte sind etwa zu einem Drittel ländlichen, städtischen oder sonstigen Regionen zuordenbar“ (S. 227).
Als Fazit nennt Karin Röhricht eine „zunehmende Privatisierung und Homogenisierung der Texte“, es dominiert die „realistische Darstellungsweise“, der inhaltliche wie ästhetische „Innovationsgrad“ ist moderat. Diese Art der Textgestaltung kommt, „sowohl dem konkreten Ablauf der Veranstaltung (Vorlesesituation, Kürze, direkte Kritik) als auch ihren Zielen, nämlich der Aufmerksamkeitslenkung des Literaturbetriebs auf neue, Marktgängigkeit versprechende Texte, entgegen“ (S. 263). „Mimetische Darstellungsweisen und narrative Strukturen sind sowohl beim Publikum als auch bei den Multiplikatoren der Veranstaltung besser anschlussfähig.“ (S. 270) So umschreibt das Ergebnis der Untersuchung den Nukleus des von der Kritik immer wieder ausgemachten typischen „Klagenfurt-Textes“.