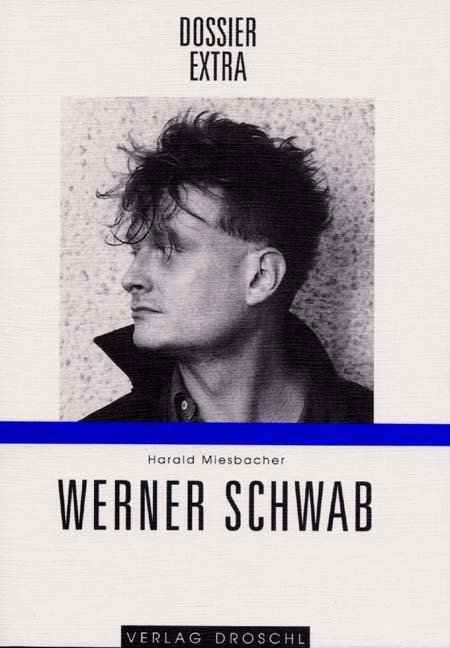Im ersten Teil des Buches widmet sich Miesbacher allerdings noch nicht der Sprache, sondern gibt einen aufschlussreichen Überblick über die Rezeption des steirischen Dramatikers in den 90er Jahren: Die Anfänge Schwabs waren – man ist versucht, ein Bernhard’sches „naturgemäß“ zu verwenden – von breiter Skepsis seitens der Kritik geprägt, etliche Journalisten fanden Schwabs Stücke geschmack- und belanglos. Bezeichnend dafür ist auch die Aktennotiz eines Dramaturgen des Burgtheaters, dem Schwab seine „Präsidentinnen“ geschickt hatte: „Durch mangelndes Sprachvermögen des Autors vieles unfreiwillig komisch. Nicht aufführbar.“ (S. 17) Später dann erkannten immer mehr nicht zuletzt. deutsche Kritiker die kunstvollen Eigenheiten des Schwabischen und stellten den Autor neben die Größen des österreichischen Theaters: „In den besten Momenten dieser monströsen Wort-Kaskaden blitzt der böse Sarkasmus Nestroyscher Prägung durch, der kakanische Grotesk-Witz Herzmanovsky-Orlandos, fallweise der bittere Wortekel Bernhards und das surreale Tohuwabohu Wolfgang Bauers“.
Der zweite Abschnitt des Bandes widmet sich der bisherigen literaturwissenschaftliche Forschung zu Schwab, danach folgt der Hauptteil des Buches, in dem Miesbacher den einzelnen „Regelabweichungen“ des Autors nachgeht – ein durchaus mühsames und umfangreiches Unterfangen allein schon der Versuch der Kategorisierung. Als erstes beschreibt Miesbacher den Gebrauch der Modalverben. So verdoppelt Schwab diese („Die brauchen nichts mehr, weil sie nichts mehr wollen wollen“; „was ich nicht erinnern kann, das kann es nicht geben können“ S. 89), dann wieder kombiniert er unterschiedliche Modalverben („Ich muss aber schon auch was sagen können“, S. 88). Vor allem das Modalwort „müssen“ wird in unzähligen Varianten eingesetzt, denn die Schwabschen Figuren sind in ihrem Handeln determiniert, sie müssen müssen, sind also auch ihrer Verantwortung für dieses Müssen und Handeln enthoben. Dies auch durchaus in „absurden“ Fällen wie etwa in „Wie ich klein sein habe müssen“ (S. 91). Überhaupt eröffnet Schwab mit seiner Verwendung der Modalverben überaus geschickt das Spannungsfeld zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit bzw. eigenem und fremdem Willen.
Ein anderes auffälliges Merkmal des Schwabischen sind die Präfix- und die Verbzusatzbildungen – auch hier gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten, die Miesbacher beschreibt: Etwa das Hinzufügen von Präfixen, die einem klassischen „Versprecher“ ähnlich sind und der Formulierung einen komplett anderen Dreh geben, etwa bei „eine eigene Familie ergründen“ (S. 95). Oder aber die verstärkende Wirkung von Verbzusätzen, wie z. B. „Lassen Sie die Fotzi ruhig ihre Worte aus ihrem Körper heraussprechen“ (S. 101) Unzählige weitere „Bearbeitungen“ der Sprache und der Syntax beschreibt Miesbacher, so den Gebrauch des Passivs, die Nominalisierung („Hast Du schon wieder das Trinken“), Pleonasmen („redliche Redlichkeitsmaschine“), Euphemismen („eine Bauchdecke aufwühlen“) etc.
Wie exzessiv Schwab mit der Sprache arbeitete, lässt sich daran erkennen, dass Miesbacher zwar die wichtigsten sprachlichen Phänomene benennt und dafür Beispiele gibt, deren umfassende Interpretation dem Autor jedoch nur ansatzweise gelingen kann: Denn schon innerhalb einer einzelnen grammatikalischen Kategorie stößt man auf so viele Folgen Schwabscher Verformung, dass eine eindimensionale Interpretation versagen muss. Abschließend weist Miesbacher darauf hin, dass Schwab mit dem Schwabischen nämlich Figuren darstellt, die gänzlich von ihrer Sprache besessen sind, die von der Sprache so dominiert werden, sodass von „Sprachkörpern“ anstelle von „Figuren“ gesprochen werden kann „Vor allem die Figuren des subproletarischen und kleinbürgerlichen Milieus sind mit ihrem desaströsen Ich als Opfer der Sprache prädestiniert“, so Miesbacher (S. 247). Das Bewusstsein, sich in einer Phrasenhölle zu befinden, führe zwangsläufig zu Aggression, zu einem „Destruktionsfuror“. Es ist auch das Bewusstsein des Verlustes von Identität. Oder auf Schwabisch: „Das Maul gehört nicht mehr uns als ein Ich.“
Erfreulich, dass der vorliegende Band als eine Art Sprachbastelbuch für das Schwabische erschienen ist – vor allem auch deshalb, weil im Umfeld der Graz 03-Bemühungen auf den „großen Sohn“ der Kulturhauptstadt vergessen wurde. Pardon, bis auf eine Veranstaltung natürlich, die im 03-Programmbuch als „körpertheatrale Raumassoziation zu Texten von Werner Schwab“ angekündigt wird. Was wieder einmal beweist, dass wir tatsächlich in einer Phrasenhölle leben…