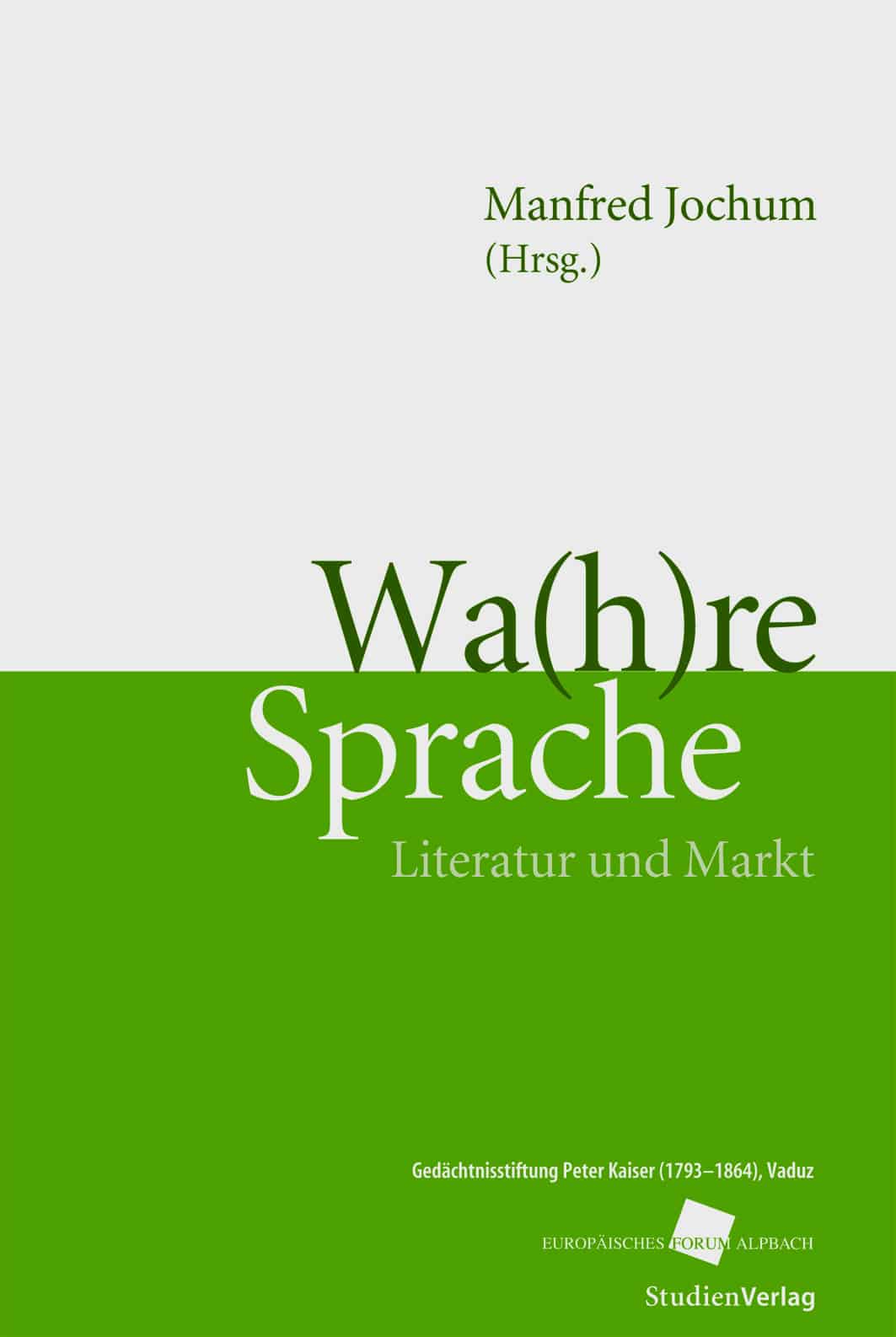Dieses Spannungsfeld bildet sich doppelt in dem Band ab: Zum einen im titelgebenden Thema der Veranstaltung, die im November 2007 in Innsbruck stattfand und sich als Teil einer Veranstaltungsreihe mit den Wechselbeziehungen von Kultur und Wirtschaft beschäftigt. Und zum anderen im erwähnten Spannungsfeld von Mündlichkeit und Schriftlichkeit: Eine Veranstaltung, interdisziplinär und naturgemäß mündlich, also etwas, was sich umgekehrt „schriftlich kaum so ausdrücken lässt“, ist in Buchform gebracht. Stärke oder Schwäche des Bandes?
Auch wenn man es sich damit leicht macht: von beidem etwas. Die thematische und methodische Vielfalt der Beiträge aus verschiedensten Bereichen des Literaturbetriebs, von Verlegern, Antiquaren, WissenschaftlerInnen, ÜbersetzerInnen, PublizistInnen, Schriftstellern und aus der Wirtschaft ist Stärke und Schwäche zugleich. Sie macht Lust auf Abwechslung und neue Perspektiven, reduziert die einzelnen Dinge aber oft auf die Idee, auf das Schlaglicht. Gegen das Ausfransen ins Individuelle bzw. Beliebige stemmen sich, um große Zusammenhänge bemüht, die sprechenden Titel der einzelnen Abschnitte des Bandes. Im Kapitel „Sprachgebrauch ist das eine, Literatur das andere“ verbindet Dieter Borchmeyer Überlegungen zu Mehrdeutigkeit und Sonderstellung des dichterischen Wortes mit historischen Prägungen der Münzen des Geistes, Rüdiger Görner diskutiert die spezifische Neukontextualisierung von Sprache in der Literatur, während Martin Reisigl die Opposition Literatur versus Sprachgebrauch aus linguistischer Sicht hinterfragt und Literatur als spezifischen und abgrenzbaren Sprachgebrauch bestimmt.
Das Kapitel „Literatur versus Literaturbetrieb“ bringt die kritischen Anmerkungen Rüdiger Wischenbarts, die beteiligten Personen spielten bei der Definition des Buches als solches keine Rolle und auch bei den Inhalten stünden die Lesenden im Schatten der Verwalter, der Verlage und Bibliotheken. Klaus Zeyringer beleuchtet historisch strategische Interessen des Establishments im Hinblick auf Literaturschaffende sowie das paradoxe Gegeneinander von Markterfolg und Wertschätzung bei der Kanonbildung: „Euro gegen Aura“.
Im nächsten Abschnitt geht es um die „Ware Buch“ und, besonders informativ, um das Büchermachen. Nikolaus Hansen erklärt das prinzipiell von Jammern begleitete Geschäft des Verlegens und schildert die gleichermaßen erfolgreiche wie kulturidealistische Arbeit seines marebuchverlags. Quasi als Kontrastprogramm folgen Klaus Reicherts als „unzeitgemäße Betrachtungen“ präsentierte „Mahnungen eines Alten“ und damit Kritisches über veränderte technische Voraussetzungen, den „Hang zum Ewig-Heutigen“ und eine Reihe weiterer Aspekte des aktuellen Literaturbetriebs. Es folgen Erfahrungen eines Sachbuch-Lektors (Klaus Stadler) und Antiquars (Heribert Tenschert).
„Übersetzungen – was sie kosten, was sie bringen“ fragen Alfred Noe (in historischer Perspektive anhand von Beispielen), Katarina Rohringer Vesović, die Preisdumping und die Misere heutiger Übersetzungsarbeit „im größeren Rahmen einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung“ sieht, und Volker Viechtbauer von der Firma Red Bull, der auslotet, wer/was sprachlich wem „Flügel verleiht“.
Der letzte Teil vor dem Abdruck des abschließenden Round table-Gespräches widmet sich der „Ware Autor“ und „Ware Text“. Karlheinz Töchterle leitet die „Ware Wort“ aus der Sophistik her, Konstanze Fliedl analysiert Images und Labels im Zusammenhang mit dem Bedürfnis des Publikums nach der Biographie der Schreibenden und Martin Kolozs fragt nach dem Arbeitsverständnis von Autorinnen und Autoren im Spannungsfeld von Idealismus und Kalkül.
Dass hier soviel Inhalt referiert wird, ist kein Zufall. Das Buch enthält vieles, was präsentiert sein will: Große Namen, Themenvielfalt, neue Ideen, kritische Anmerkungen; das alles aber unter dem vagen, ambigen Dach der vielseitig einsetzbaren „Wa(h)re(n) Sprache“.