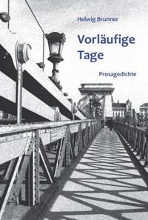In seinem achten Lyrikband (nach Süßwasser weinen und Schuberts Katze) wählt er die Form des Prosagedichts.
Manche Texte sind dabei nur wenige Zeilen lang, andere ausschweifender. Gemein ist den Gedichten eine geometrische Anordnung und ein starker persönlicher Fokus. Nicht das „Was“ ( = Thema und Motiv) macht Brunners Werk aus, sondern das „Wie“. Aus welcher Perspektive nähert man sich dem Stoff? – Diese Frage ist hier zentral.
Helwig Brunner, geboren 1967 in Istanbul, scheint bei sich selbst zu beginnen: Er, ein Mitt-Vierziger, beschreibt (s)ein Leben, in dessen Mitte er sich befindet. Es ist ein Alter, in dem vieles durchlebt wurde, also hinter einem liegt. Vorbei ist die Zeit der pubertären Orientierungssuche (die im Übrigen viel Stoff für Poesie liefert), vorbei sind die ersten Enttäuschungen und Lieben. Erfolge wurden gefeiert, bevor sie verflogen. Eine gewisse Abgeklärtheit scheint sich in dieser Lebensphase einzustellen, ebenso Zuversicht. Und doch gibt es nach wie vor das Unvorhersehbare. Zukunft ist ungewiss, mit der einzigen Gewissheit, dass es irgendwann ein Ende gibt.
In Brunners Gedichten geht es um das Begreifen. Das lyrische Ich nimmt die Vergänglichkeit an, akzeptiert die Gegenwart und setzt sich mit den Prioritäten und Bedeutungen, die sich ständig verschieben, auseinander. Brunners Gedichte sind geprägt von philosophischen Zügen. Und natürlich ist auch Gesellschaftskritik zu finden. Da wird der Smalltalk und die Schnelllebigkeit der Umwelt kritisiert, die Trägheit im bestehenden politischen System.
Eingeteilt ist der schmale 104-Seiten Band dabei in vier Abschnitte: „Die sanfte Unvernunft“, „Reiseflimmern“, „In den Koordinatengittern“ und „Das Verlassen der Vorläufigen Tage“.
Vorläufige Tage ist ein Buch voller Wendungen. Kein Gedicht gleicht dem anderen, manche Texte werden erst durch lautes, wiederholtes Lesen klar, zumal die Sprache stellenweise stark verdichtet ist. Brunner kommt mit wenigen Metaphern aus. Er setzt Sprache gezielt ein, um das (eigene) Leben zu beschreiben. Aber auch das Scheitern der Sprache ist Thema. Sprachreflexion ist vordergründig.
Der persönliche Zugang wird verstärkt durch Brunners Biografie, die unverkennbar die Texte prägt. Da erkennt man Brunner, den Biologen. Und auch Brunner, den Musiker. Ebenso kommt die Liebe zur Fotografie durch, wenn er etwa in einem Gedicht von Pixelwolken und einer Auflösung von 300 dpi schreibt. Selbst das Coverfoto der Kettenbrücke in Budapest hat Brunner selbst geschossen.