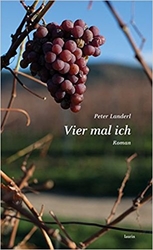„Fest gefügt. Eine Reminiszenz (Das erste Ich)“ schweift zurück in die Kindheit des Erzählers in ein kleines Dorf in den Vogesen, das von der „Revolution vergessen“ wurde, dort, wo „nicht republikanisch gedacht“, sondern „katholisch-archaisch gelebt“ wird (S. 11). Die vermeintliche Sicherheit des Dorfes mit seinen starken religiösen Ritualen bewegt sich jedoch immer an der Grenze, der Grenze zwischen der deutschen und französischen Kultur und Sprache, der Grenze zwischen Berg und Tal, zwischen „Schein und Schein, Widerschein und Widerschein“ (S. 17). Die festgefügten Formen kulminieren in der Gewissheit des Felsens, auf der die unverrückbare Dorfkirche gebaut ist: „Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt.“ (S. 16)
Das „zweite Ich“ – „Wie alles verloren ging in den Jahren“ nennt Landerl eine „Klage“, gerichtet in erster Linie an sich selbst, zumal die Trennung von seiner Frau Maren und damit die Trennung von seinem Sohn Philipp und der Tod seines Vaters ihm jede Weltzuversicht zerstört haben. Der Verlust des Vaters vor allem ist es, der ihn die Hoffnung verlieren lässt. Er beginnt an seinem Beruf zu zweifeln, erlebt die lange angestrebte feste Anstellung an der Universität weniger als Befreiung denn als Gefangenschaft, der er sich mehr und mehr zu entziehen sucht. Er räumt sein Bücherregal, wirft die Bücher in den Müll, auch das antriebslos, freudlos. „Wie ich mich nicht freuen konnte über meine Habilitation, weil die Szenerie eine miese Aufführung akademischer Laiendarsteller war, (…)“ (S. 26) Fast akademisch rekapituliert er seine berufliche Laufbahn, die Trennung, den Tod, nun weniger distanziert, als Ich-Erzähler, subjektiv, nahe. Die Flucht aus dem Leben hinein in die Literatur ist nicht geglückt. Ausgerechnet bei einem Handke Symposium beginnt die erste Sinnkrise.
Das längste der drei Kapitel, „Mon coeur mis à nu. Marginalien (Mein drittes Ich)“ sind Gedankenfetzen. Das Erzählen fällt auseinander, Randbemerkungen, Marginalien eines am Leben ermüdeten 43jährigen. Die eigene Statik, das Unbewegliche, das uneigentliche Leben, das er führt, bildet sich in Beschreibungen, Umwelten, der Natur, in seiner Beziehung zu seinem Sohn vielfach ab. Am Ende bleibt Entfremdung, Entfremdung sich selbst gegenüber. Der Versuch, sich selbst im Erzählen Rechenschaft abzulegen misslingt. Eine neue Beziehung zur Malerin Alice scheint Hoffnung zu geben, aber diese ist durch ihre unerklärbare Erkrankung belastet.
Mehr und mehr treten Texte anderer Autoren anstelle des eigenen Wortes, Michel Houllebecq, Tomas Tranströmer, Peter Hacks. Sie werden zum Sprachrohr, in ihren Texten versucht sich Aurélien zu artikulieren. Immer wieder wechselt die Perspektive in die Totale, stellt sich der Darsteller hinter die Kamera. Dennoch: „Wir sind gefangen in der Ich-Perspektive (…)“ (S. 120).
Das „neue Ich“ ist am Ende nicht mehr als „ein Zittern in der Natur“, versinnbildlicht in „Krankenhaus“, einem Bild von Maria Lassnig, das nun zum Titel aller Bilder, die Alice malt, wird.
Aurélien ist ein von seinem Leben, seinem Beruf Enttäuschter, ein Orientierungsloser, der zunehmend den Halt nur mehr im Äußerlichen findet. Sein Sohn besucht ihn alle zwei bis drei Wochen, zu wenig, aber dennoch geschieht dies mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Der Ablauf der Jahreszeiten, die Wiederkehr der sich verändernden Natur im Jahreslauf, auch Ereignisse wie der Anschlag auf Charlie hebdo in Paris am 7. Jänner 2015 oder der Absturz der German Wings Maschine über Südfrankreich etwa drei Monate später, die in den Text eingewoben sind, sind der Versuch sich selbst und sein Leben im Hier und Heute, in der Gegenwart zu verorten. Die innere Sicherheit hingegen ging mit den zahlreichen Abschieden, die er nehmen musste, verloren.
Landerls Roman bewegt sich nicht nur inhaltlich, sondern auch formal und sprachlich zwischen zwei Welten, der inneren und der äußeren, zwischen zwei Kulturen, Sprachen, zwischen Erzählung und tagebuchartigen Notizen, Geschichten und Sequenzen, Ereignissen und Gedanken. Das Ich, das schon Anfang des 20. Jahrhundert als „unrettbar“ galt, ist zu Beginn des 21. endgültig in einzelne Teile zerfallen, hier zumindest in vier.