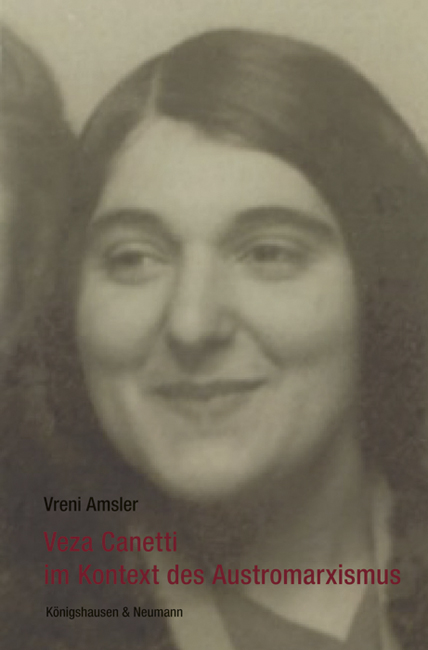Amsler setzt Canettis Schreib- und Denkweise in Beziehung zu den Strömungen des Austromarxismus, denen Canetti nicht nur konkret durch Publikationsorgane und persönliche Kontakte, sondern auch intertextuell und thematisch verbunden war (S. 19-180). So verhandelt Canetti den zeittypischen Diskurs über Herrschaft und Knechtschaft auf mehreren Ebenen und reflektiert dabei unterschiedlichste Sozialismustheorien von Max Weber (dessen Vorlesungen an der Universität Wien sie vielleicht besuchte, vgl. 22f.), Karl Marx, Friedrich Hayek oder Josef Popper-Lynkeus. Ebenso steht Canetti dem Denken der Empiriokritizisten nahe, hier insbesondere der Wissenschaftlichen Weltauffassung und Felicitologie sowie den Ideen der Volksbildung eines Otto Neurath (S. 58-76). Aus dieser Perspektive könnte eventuell Canettis als verschollen geltender Roman Die Genießer an theoretische Erörterungen Neuraths in Bezug auf Genießen und Nichtgenießen im Reich des Schönen anknüpfen. Sehr ansprechend spekuliert Amsler in diesem Zusammenhang auch darüber, dass dieser verlorene Roman in dementsprechend akzentuierter Umarbeitung in der Gelbe Straße vorliegt (73f.). Denn in den zum Roman erweiterten Erzählungen Der Kanal, Der Zwinger und Ein Kind rollt Gold setzt sich Canetti mit dem allzu raschen und unüberlegten Genießen ihrer Protagonisten auseinander. Deren auf kurzfristigen Genuss ausgerichtetes Leben führt auch mangels einer zukunftsgerichteten Perspektive zum Nichtgenießen-Können des Lebens bzw. gar zum Tod.
Die Rolle der Frau ist auch ein die austromarxistischen Diskurse sowie Canettis Werk bestimmendes Thema, wobei Canettis Interesse neben den politischen und rechtlichen Fragen insbesondere deren psychologischen Dimensionen gilt (S. 87-138). So wie die Wiener Sozialwissenschaftlerin und Leiterin des Frauenreferats der Arbeiterkammer Käthe Leichter fokussiert Canetti bevorzugt die Lebensumstände von Frauen der Unterschicht und publiziert ihre Texte ebenfalls in der sozialdemokratischen Arbeiter-Zeitung. Amsler weist hier sehr überzeugend nach, wie Canettis literarische Verhandlungen über Arbeitsbedingungen, Selbstmord und Prostitution im Arbeiter- und Dienstbotenmilieu (z. B. in den Erzählungen Der Kanal oder Der Sieger) zu sehr ähnlichen Resultaten wie Leichters sozialwissenschaftliche Feldforschungen zu Hausgehilfinnen, Heimarbeiterinnen und Industriearbeiterinnen kommen. Canetti diskutiert diese soziologischen Erkenntnisse ironisch und gestaltet diese durch den gezielten narratologischen Einsatz von direkter Rede, Reflektorfiguren und einer kommentierenden Erzählstimme auch auf formaler Ebene aus. Psychologisch orientiert sich Canetti an der mit der austromarxistischen Pädagogik und Volksbildung eng verbundenen Individualpsychologie Alfred Adlers, sie analysiert die Frauenprobleme der Gegenwart auf literarischer Ebene in ähnlicher Weise wie Alice Rühle-Gerstels theoretische Ausführungen. So setzt Canetti nicht nur Rühle-Gerstels verschiedene Frauenkategorien wie die ideale Frau, die Künstlerin, die Barmherzige oder die Kapitalistin literarisch um, sondern setzt sich auch mit den Bedeutungsfeldern Mütterlichkeit und Allmütterlichkeit auseinander und macht auch vor der Selbstanalyse ihres lebenslangen Konflikts zwischen barmherziger Dichtersgattin und eigenständiger Dichterin/Künstlerin nicht Halt. So leiden Canettis Frauenfiguren auch in Rühle-Gerstels Sinne weniger daran, kein Mann zu sein oder nicht dieselben Rechte wie ein Mann zu haben, sondern vielmehr an ihrem inferioren Status in der kapitalistischen Klassengesellschaft.
Auf poetologischer Ebene verortet Amsler Canetti in der Nähe der austromarxistischen Literaturtheorien eines Ernst Fischer (S. 139-180), mit dem die Schriftstellerin auch freundschaftlich verbunden war. Die austromarxistische Forderung nach der Darstellung des Geistes der Solidarität, des neuen Menschen und der Menschenwürde in der Literatur reflektiert Canetti kritisch und entwickelt sie weiter. Fischers Forderung an die Dichter nach dem „Nicht-Beschönigen der Verhältnisse“ (Die Entdeckung unserer Welt. In: Arbeiter-Zeitung, 1.1.1931) greift Canetti wohl am eindringlichsten in ihren drastischen Beschreibungen der Lebensumstände der Familien Mäusle und Prokop in ihrer Erzählung Geduld bringt Rosen auf.
In einem zweiten Teil beleuchtet Amsler Canetti im Kontext der (Wiener) Literatur- und Intellektuellenszene der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (S. 181-285). Die Figuren ihrer roten Gustis und Gustls (in Geduld bringt Rosen, Der Dichter, Die Gelbe Straße, Hellseher) können nicht zuletzt ihrer eindeutigen Charakterisierung auf figurensprachlicher Ebene wegen als Fortschreibungen von Arthurs Schnitzlers Lieutenant Gustl gelten, ihr Roman Die gelbe Straße ist auch als Dekonstruktion von Franz Theodor Csokors expressionistischem Drama Die rote Straße zu lesen. Mit Fokus auf die zahlreichen Dienstmädchenfiguren in ihren Texten sowie im Hinblick auf die Würde des Menschen tritt Canetti in einen Interdiskurs zu Hermann Brochs Menschenrechtsvorstellungen, wie er sie in seinem Roman Die Schuldlosen ausgestaltet hat. Vor allem in ihrem Spätwerk reflektiert Canetti die Rolle des Dichters und Künstlers in der Gesellschaft. Mit Ernst Fischer und Manès Sperber, die Kultur als unabdingbare Voraussetzung für den Sozialismus sehen, geht es ihr darum, die Welt besser zu machen und die Menschenwürde zu retten. Formal steht sie sowohl den Präferenzen der Neuen Sachlichkeit für die kleine Form nahe als auch der Montagetechnik eines Karl Kraus, die von Elias Canetti für seine Figuren beanspruchte Technik der „akustischen Maske“ ist in den Texten seiner Ehefrau ebenfalls präsent. Diese intertextuellen Zusammenhänge gehen vielfach auf reale Kontakte zurück: So war Veza Canetti gemeinsam mit ihrem Ehemann Teil zahlreicher Künstlerkreise der Zeit, wie z. B. jenem um Abraham Sonne in Wien oder im englischen Exil an jenem um Franz B. Steiner.
Amslers Studie über die Netzwerke von Veza Canetti ist tatsächlich sehr instruktiv. Sie beeindruckt durch die Fülle der ausgewerteten Materialien und die in dieser Form bis dato noch nicht sichtbar gemachte Darstellung von Canettis persönlichen und intertextuellen Kontakten und Verbindungen. So hat Amsler neben den nicht gesperrten Teilen des Canetti-Nachlasses in Zürich auch zahlreiche andere Nachlässe und Archive (Österreichisches Literaturarchiv, Wienbibliothek, Literaturhaus Wien, Literaturarchiv Marbach, Münchner Stadtbibliothek, Akademie der Künste Berlin, Deutsches Exilarchiv in Frankfurt/Main, Hermann-Broch-Archiv in Yale) eingesehen, in denen auch bisher unbekannte Korrespondenzen Veza Canettis mit z. B. Hermann Broch, Erica Kalmer, Josef Kalmer, Hermann Kesten, Robert Neumann, Ernst Schönwiese, Theodor Sapper, Trude Waehner, Cilli Wang u. v. a. zutage befördert wurden. Dass hier aber immer noch viele Schätze (und auch noch weitere Pseudonyme) zu heben sind, macht Amsler in einem an den Textteil anschließenden Anhang deutlich, in dem sie Veza Canettis Publikationsgeschichte und ihre politisch-ideologischen sowie künstlerischen Netzwerke nachzeichnet. Warum diese grundlegenden Informationen (abgesehen von der Bibliographie und den Quellennachweisen) allerdings am Ende des Buches platziert sind, ist leider nicht schlüssig. Auch das Inhaltsverzeichnis, das nicht an erster Stelle im Buch, sondern sinnwidrigerweise erst nach Vorwort und Zusammenfassung (!) auf S. 11 auftaucht, versagt in diesem Punkt; als Leser wird man nur lapidar auf den „Anhang“ mit „Bibliografie“ (die man wegen einer falschen Seitenangabe auf S. 389 dort vergebens sucht) und „Archivmaterial, Grundlagen, Quellen“ verwiesen, um auf S. 335 mit einem erneuten, sehr ausführlichen Inhaltsverzeichnis zum Anhangsteil mit nicht geringem Umfang (S. 335-400) überrascht zu werden. Leider ist das Formale im Gegensatz zum Inhaltlichen generell keine Stärke dieser Studie, die ursprünglich als Dissertation an der Universität Zürich verfasst wurde: Neben einigen ärgerlichen Druckfehlern vor allem bei Personennamen sticht die konsequente ss-Schreibung, die wissenschaftlichen Zitierusancen zum Trotz auch auf Werktitel, Eigennamen und Zitate angewandt wird, ins Auge. Hier hätte ein gründlicheres Lektorat sowohl von Seiten der Autorin wie auch des Verlages (wenn es denn dort ein solches überhaupt gab) stattfinden müssen, wobei man idealerweise auch gleich einige sprachliche Redundanzen und insbesondere die unnötig repetitive Zitierweise in den Fußnoten kürzen hätte können. Dann wäre vielleicht auch noch Platz gewesen, um einen Index unterzubringen, mit dessen Hilfe die zahlreichen Personen- und Werkverweise benutzerfreundlicher aufzufinden wären. Dieses Manko ist umso verwunderlicher, da Amsler auf S. 394 schreibt, eine „Stichwortliste, vor allem die Zwischenkriegszeit Wiens und den Austromarxismus betreffend“ erstellt zu haben, auf deren Grundlage Johanna Canetti den gesperrten Nachlass ihres Vaters durchsucht hatte.
Diese Unzulänglichkeiten formaler Art sollen aber keineswegs die unbestrittenen Meriten von Amslers Studie schmälern. An diesem Buch wird die zukünftige Forschung zu Veza Canetti nicht vorbeikommen. Für die auch von Amsler eingemahnten Forschungsdesiderata wie einer Neuedition des (Gesamt-)Werks der Autorin sowie der immer noch ausstehenden Biographie der Autorin bzw. einer Doppelbiographie des Dichter(ehe)paars Canetti hat sie selbst eine wichtige Grundlage geschaffen.