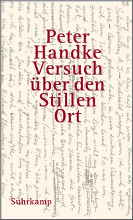Der Essayist Handke verspricht, in diesem „Versuch“ seine Geschichte mit dem stillen Ort nachzuerzählen beziehungsweise „nachzuziehen“, und zwar parallel beziehungsweise kontrapunktiert zu A. J. Cronins Roman „Die Sterne blicken herab“, in dem der junge Held an einem „Stillen Ort … ohne Dach, offen zum Himmel“ (S.10) sitzt.
Der Autor fängt bei den Kindheitsklosetts in Ostberlin und im Südkärntner Großvaterhaus an, die aber kein Rückzugsort waren, weil er einen solchen – noch – nicht benötigte. Er bleibt bei seinem ersten Internatstag im Kärntner Tanzenberg/Plešivec stehen, als beim Abendessen zuerst einmal alles in seine Hose geht … vom „Schritt“ aus und „klammnaß“. (S.18.) Später war das „Klosett“ während der Internatsjahre sein „Asylort“. (S.21)
Nach einem großen Zeitsprung befindet er sich eines Nachts in Spittal an der Drau, mehr oder weniger bargeldlos, weshalb ihm als Übernachtungsoption nur das Bahnhofsklo bleibt, das er mit einer 1-Schilling-Münze öffnet und wo er sich einsperrt: „Die Kabine war freilich so klein, daß an ein Ausstrecken nicht zu denken war, und deshalb habe ich mich, den Kopf an der Hinterwand, in einer Art Halbkreis um die Klomuschel geringelt.“ (S.34.) Gleichsam die ersten Clochard-Erfahrungen des nachmaligen Paris-Bewohners, der sich dabei, trotz der Entrichtung der Eintrittsgebühr, als ein Illegaler empfand. Assoziativ erwähnt er zur Spittaler Bahnhofstoilette kurz die Entstehungsgeschichte seiner „Wiederholung“ und ihres Helden Filip Kobal, der sich in einer ähnlichen Situation oder vielmehr Umgebung wiederfindet.
„Während der Studienjahre verlor das Klosett als Asylort an Bedeutung.“ (S.42.) Seine Stelle nahmen andere Örtlichkeiten ein, in, an und unter denen Unterschlupf zu finden war, eine Rampe, eine Wahlplakatwand oder sonst etwas. Andererseits fand er seine stillen Orte mitten im Getümmel, im Tumult der Universitätsmensa, wo er William Faulkner, den er zeitlebens erwähnt, las. Auch in diesen „Versuch“ sind – neben Cronin – einige Leseerfahrungen eingesprengselt, zum Beispiel mit Thomas Mann, Tanizaki Jun’ichiro oder Thomas Wolfe, und so heißt es: „Nicht wenige Bücher habe ich gelesen, viele Photos habe ich betrachtet als Vorarbeit für diesen Versuch über den Stillen Ort. (…) Aber kaum etwas davon hat in diesem seinen Platz gefunden.“ (S.84.)
Das Studienklosett im Universitätsgebäude bekam andere Bedeutungen und wurde an einem Abend beispielsweise zum Ort für Handkes Haarwäsche, beobachtet von einem Professor, der, auch nicht faul, sich für den Besuch eines Tanzcáfes herrichtete, und sich, man glaubt es kaum, unter anderem „mit einer Miniaturschere die Härchen aus Ohren und Nasenlöchern“ schnitt (S.56), was als Episode zu einem „gemeinsamen kleinen Geheimnis“ (S.56) zwischen Professor und Studenten wurde.
Handke holt zwischen den einzelnen Bedürfnisanstalten weit aus, reflektiert über sich und meint, „gar nicht so einzelgängerisch und außenseiterisch“ gewesen zu sein: „Ein bißchen sonderbar, ja, aber es gab Sonderbarere.“ (S.60.) Und dann die Selbsterkenntnis: „Von einem Weltstar weit entfernt“. (S.61.) Wie weit?
Es folgen Flugzeug- und Zugtoiletten, aus Klos quellendes Filmblut und die Behauptung, der Haiku-Dichter stoße auf japanischen Tempelgartentoiletten „auf zahllose Motive“ (S.69). Der Autor vergisst nicht auf Friedensreich Hundertwassers neuseeländisches Klo und preist es. Allein seinetwegen sollte man, empfiehlt er, dorthin reisen. (Und Marie-Antoinette isst weiter Kuchen…) Handke erwähnt sogar die Sphärenmusik mancher luxuriöserer Orte.
Die „nachjapanischen Jahre und Jahrzehnte“ (S.77) nutzte er zu Gesellschaftsstudien, womit beileibe nicht die Abortinschriftenlektüre, die Handke „Flapsereien und Sperenzchen“ (S.78) nennt, gemeint ist, sondern die Muster, die brennende Zigaretten auf der WC-Keramik hinterlassen, wohin sie zum Wasserlassen und folgendem Händewaschen abgelegt wurden, aus denen aber rein gar nichts herauszulesen ist, weder eine dramatische noch epische Spur. Die Glut- seien jedenfalls keine Kampfspuren.
Nicht verschwiegen sei die Forschungstätigkeit des Essayisten auf den Stillen Orten, die er weltweit fotografiert habe. Er sei, „einmal drinnen“ (S.81), immer auf der Suche nach den geometrischen Gestalten gewesen, wobei er Kegelstümpfe, Kreise, Ovale, Zylinder, und, und, und entdeckte. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass Handke nicht an Hinterlassenschaften, sondern Äußerlichkeiten denkt. „Aber Schluß jetzt mit der Ironie; nicht zum ersten Mal erkenne ich, daß die, zumindest im Schriftlichen, nicht meine Sache ist.“ (S.82.)
Die Orte seien „pittoresk, mondän, versnobt, rudimentär, erbärmlich, weltverlassen“ gewesen (S.87) und er habe sie in der obersten Etage von Wolkenkratzern und in den letzten Wellblech-Favelas gesehen. Von manchen Balkantoiletten, meint der notorische Serbien-Interessenvertreter, schweige er lieber, lässt aber nicht unerwähnt, dass im Jahr 1999 ein kleines Mädchen im Jugoslawien-Krieg „von einem Bombensplitter, quer durch die Klosettwand, getötet worden ist.“ (S.95.)
Nicht uninteressant ist Handkes Nomenklatur der Stillen Orte, hier seien beispielsweise und ohne Vollständigkeitsanspruch einige seiner Begriffe erwähnt: Abort, Abtritt, Astronautenaborte, Barklosett, Bedürfnisanstalt, Friedhofstoilette (in Japan!), Gemeinschaftstoilette, Klosett, Stiller Ort, Tempelabort (auch in Japan), Todeszellen-Abtritte und WC.
Von diesem „Versuch“ dürfen sich die LeserInnen keine ethnologische oder historische Abhandlung über den „Bedeutungswandel der Notdurftverrichtung“ (S.84) erwarten. Keine Untersuchung über mehr oder weniger Scham beim Geschäft, das schon einmal öffentlicher verrichtet wurde als in der Jetztzeit. Naturgemäß wechseln die Stoffwechselsitten nicht nur in der Zeit, sondern – so die Erkenntnis des Autors – auch von Volk zu Volk. In Handkes „Versuch“ geht es jedenfalls kultivierter zu als in den berühmten „Feuchtgebieten“.
Der Schluss dieses Versuchs aber ist ein einzigartiger Höhepunkt, nämlich einer der gekonnten Naturbeschreibung, einer sonst selten gelesenen mit genauesten Begriffsbestimmungen vom „Fasanengieksen“ über das „Eselstöhnen“ (S.101) bis zu den „klitzekleinen Ellipsen des Hasenkots“ (S.105). Es ist ein Schluss, der letztlich, fast zu spät, ein doch überzeugendes Buch bewirkt.