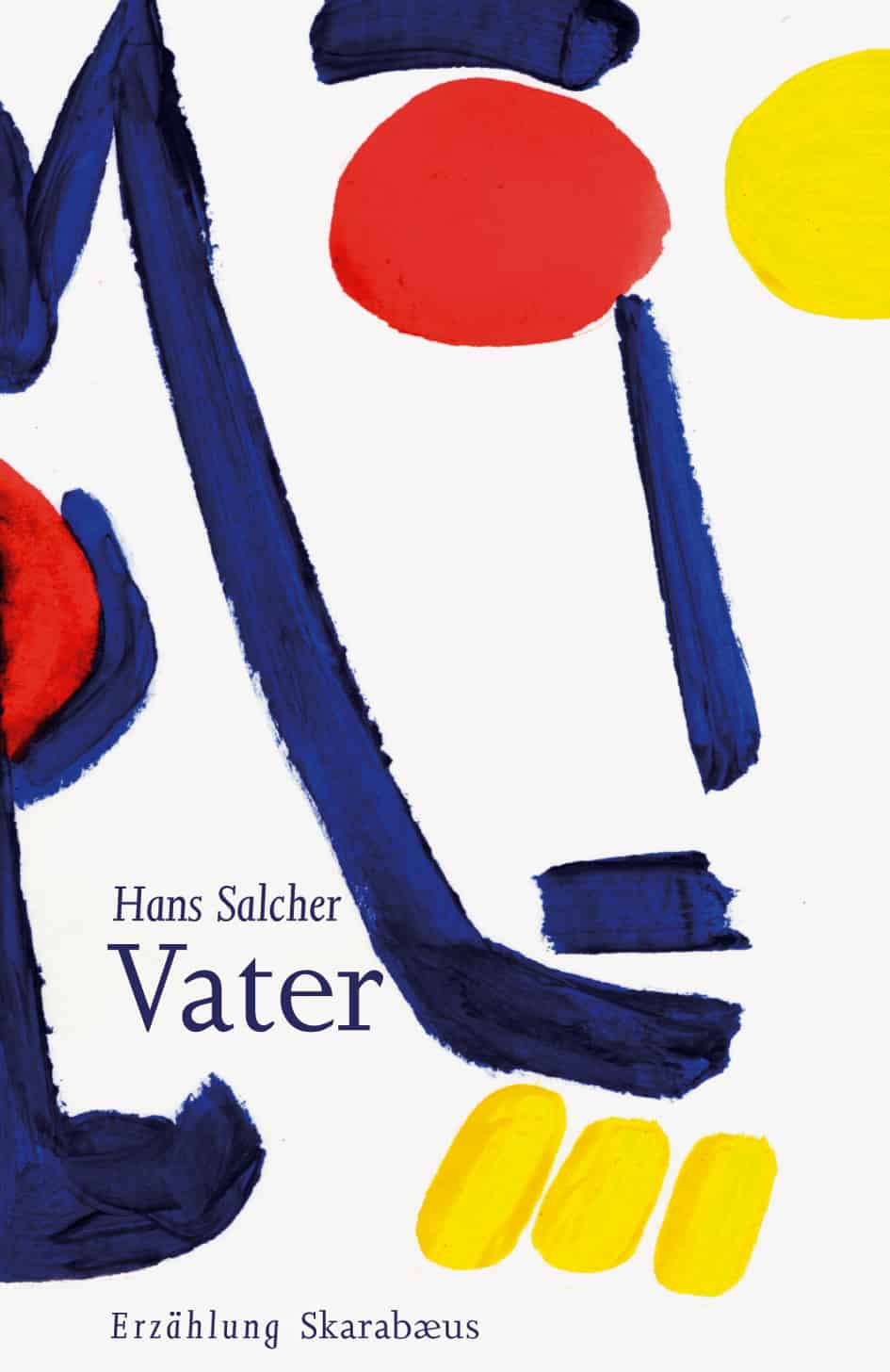Die Mentalität der Menschen, die in diesem Bergdorf leben, wird eingehend beschrieben in einer Aufbahrungs- und Beerdigungsszene. Die Schwester des Vaters ist gestorben. Noch an der Stiege liegend wird sie flankiert von trauernden Gästen, die dann den Schnaps leertrinken, während der Sargtischler von der Toten Maß nimmt. In einem Dorf ist man nicht allein, das ist das Schöne, das ist das Fatale. Selbst beim Trauern wird man nicht allein gelassen, denn: „Trauerte man nicht, war man ein Ungläubiger, man hatte zu trauern, da half keine Ausrede.“ Ein „Totenessen“ im Gasthaus gehört auch dazu, genauso wie die Raufbolde, die den Tag mit einer Prügelei enden lassen.
Der Vater, um den es sich hier handelt, ist ein Sonderling. So wird er anfangs von allen angefeindet. Die Dorfmenschen verspotten ihn, weil er in die Stadt flüchtet, anstatt der Familie auf dem Feld zu helfen. Er sammelt Spiegel, trägt im Sommer einen dicken Mantel und besteigt keine Berge. Seine Verwandten schämen sich, die Mutter versteht nicht, weshalb er sich nicht anpasst. Für das Kind ist der Vater der wortlose Held, der jedoch etwas ganz Wichtiges kann: lachen aus ganzem Herzen.
In dieser kargen, engstirnigen, ja brutalen Welt, in der ein Singvogel bei lebendigem Leib den Katzen zum Fraß hingeworfen wird, sobald er nicht mehr singt, ist der Vater die positive Figur, die das Kind Gegenwelten in der Natur wie auch in der Kultur kennen lernen lässt. Im Wald hat er ein Häuschen aus Stein und Ästen errichtet, wohin er sich zurückzieht. Auch dort versteckt er seine Spiegel, die er sich und der Welt entgegenhält: Schaut, das sind wir. Nichts weiter. Der Vater begehrt nicht auf, er lässt seine Taten sprechen. Diese spiegeln das Gute, das überspringen soll. Er zeigt dem Sohn die Stadt, in der er sich wohl fühlt. Der Junge erlebt sein erstes Theaterstück, in welchem ein Spiegelmann auftritt, der Folgendes spricht: „Wer mich nicht sieht, sieht sich selbst nicht.“ Der Vater umarmt den Spiegel und küsst ihn. Die Stadt ist bunt und voller Leben. Auf dem Pferdemarkt darf sich der Sohn ein Fohlen aussuchen. Es ist weiß und wunderschön – doch die Freundschaft zwischen den beiden ist nur von kurzer Dauer. Auch in der Stadt sind dem Vater allerdings nicht alle wohl gesonnen. Als er in einem Gasthaus angegriffen wird, wehrt er sich nicht. Er bleibt der stumme Held, dessen Messianismus irgendwann von den DorfbewohnerInnen erkannt und geschätzt wird. Schlussendlich kann er sogar als Künstler alle in seinen Bann ziehen. Das ganze Dorf kommt, um die Bilder zu sehen, die er aus Körnern, Schnee und Erde auf seine Felder „gemalt“ hat.
Märchenhaft mutet diese Erzählung von Hans Salcher an. Auch märchenhafte Gestalten kommen ansatzweise vor, wie z. B. eine Frau mit weißen „Schleierhandschuhen“, die den Buben gern bei sich behalten möchte. Die Erzählperspektive ist jene des Kindes, allerdings rein beschreibend. Dessen Gedanken und Gefühle finden keinen Ausdruck. Das mag wohl so beabsichtigt sein, hat doch dieses Dorfkind keine Gefühle zu haben und zu zeigen:
„Mich vergaßen sie, Kinder waren unwichtig im Dorf, sie existierten nur als Arbeiter. War ein Kind fleißig, so sagten die Leute, es wird ein guter Arbeiter, aber wenn es spielte oder im Gras lag, war es in ihren Augen ein Lump, ein Taugenichts.“
Schade, dass sich diese kindliche Zurückhaltung konzeptuell widerspiegelt. Gerade die Kindperspektive würde es ermöglichen, das komplexe Gedanken- und Gefühlsleben auszubreiten. So bleiben die märchenhaft schaurigen oder abenteuerlichen Szenen oft leblos gefangen in ihrer Textlichkeit. Und doch erinnert noch einiges an den Band Worte haben ein Bild gemalt aus dem Jahr 2006, wenn es z. B. heißt: „Der Herbst war eingezogen, im Dorf malten viele Farben.“