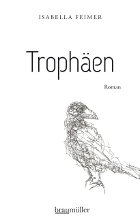Ihre leidenschaftliche Verknüpfung von Bild und Wort äußert sich im Roman Trophäen in einer poetischen und metaphorischen Sprache, deren Intensität Gänsehaut zu erzeugen vermag. In einer Schatzkiste sind schreckliche Erinnerungen sowie beklemmende Gefühle, die sich als Familienpolaroids tarnen, versteckt. Die Vergangenheit lässt die Romanheldin nicht los, weshalb sie sich zusehends in sich selbst zurückzieht. Eine innere Leere und Kälte, die symbolisch als Winter erscheint, beschleicht sie.
Seelisch tot zu sein, sich aber lebendig fühlen zu wollen – dieser Gemütszustand zieht sich leitmotivisch durch den Roman Trophäen. Dass Totes doch lebendig sein kann, erfährt die Romanheldin erst durch einen Tierpräparator und Maler, zu dem sie sich wie magisch hingezogen fühlt. Ihre Faszination und Aufmerksamkeit gilt jedoch in erster Linie nicht dem Mann, sondern seinem Handwerk, tote Tiere ästhetisch auszustopfen, mit ihnen eine Geschichte zu erzählen.
Die ungewöhnliche und morbide Romanze mit dem Tierpräparator wird für die Romanheldin zu einem Tor in ihre eigene Vergangenheit. Ihre kindliche Seele hat die Kränkungen durch ihre Mutter und ihre Schwester nie verarbeitet. Der Schwesternzwist steht im Mittelpunkt des Romans Trophäen, er ist der Beweggrund für den Ausbruch der Romanheldin aus der Normalität.
Isabella Feimer entwirft eine verkehrte Welt, in der oben und unten vertauscht sind und die von Düsternis geprägt ist. Sie stellt den kompromisslosen Kontrast zur glänzenden, oberflächlichen und klischeehaften „Seifenblasenwelt“ der Schwester dar. Damit eröffnet sich für die Romanheldin erstmals die illusorische Möglichkeit, mit ihrem Schicksal umzugehen und es anzunehmen.
Eine Welt, in der alles ein bisschen anders, nämlich verrückt, wild, tierisch und fabelhaft ist, erlaubt es auf groteske Art und Weise, dass sie ihre Schwester präpariert, so wie Tiere für das Naturkundemuseum ausgestopft oder gejagte Tiere als Trophäen zu Hause an der Wand aufgehängt werden. Die präparierte Krähe und das Obsiegen über die Schwester sind für die Romanheldin die titelgebenden Trophäen. Die Krähe, die sich auch auf dem Buchcover befindet, steht symbolisch für Zerstörung und Erneuerung. Die Romanheldin identifiziert sich mit dieser Rabenvogelart.
Trophäen ist kein klassischer Liebesroman, sondern ein Roman, der mit unbändiger Fantasie überrascht und durch eine außergewöhnliche, ja abnorme Charakterzeichnung besticht. Es geht nicht darum, welche Eigenschaften die Figuren haben oder nicht haben oder welche Ziele sie erreichen wollen. Die Figuren waren in ihrer Vergangenheit Opfer und Täter und sind es in der Gegenwart noch. Sie werden durch den Kraftakt, die Vergangenheit bewältigen zu wollen, geprägt.
Die verkehrte Welt, die von Isabella Feimer in Trophäen kreiert wird, spiegelt sich in ihrer Sprache wider. Verben werden dort und da ausgelassen, Fragezeichen in Sätze integriert, und zahlreiche Nebensätze bleiben skizzenhaft. Neologismen wie „schatzkistenversperrt“ und „Milchglasmomentaufnahmen“ unterstreichen den sehr persönlichen Sprachstil. Der Roman besteht aus 46 Kapiteln, in denen jeder Satz zugleich ein Absatz ist, rhetorisches Geschick zeigt die Autorin dabei mit dem Stilmittel der Anapher. Mit Leichtigkeit gelingt Isabella Feimer der zügige Wechsel zwischen den verschiedenen Erzählperspektiven. Gefühle, beispielsweise die Feigheit, werden personifiziert. Indem sich Menschen und Gegenstände vereinigen, wird Materie aufgehoben („um wieder eins zu werden mit dem dunklen Thekenholz“ S. 26).
Der poetische Höhepunkt in Trophäen ist das Gedicht über die Krähe, das auch von der Hintergrundstimme im Video-Trailer rezitiert wird.
Isabella Feimer sprengt mit ihren fantasievollen, originellen und poetischen Worten die prosaischen Grenzen des Romans und kreiert mit ihrem Schreibstil einen hohen Wiedererkennungswert.