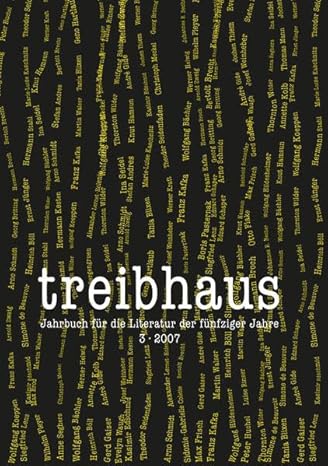Trotz des eindeutig (west)deutschen Titels ist der zehnte Band dieses Jahrbuchs dem Nachbarland Österreich gewidmet. Dabei werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den beiden deutschsprachigen Ländern zwar gelegentlich in den Blick genommen. Im Wesentlichen jedoch wird die österreichische Literaturentwicklung ohne Seitenblicke ins größere Deutschland dargestellt. Schon das Editorial des Jahrbuchs legt dar, dass es hier um Eigenheiten der österreichischen Literatur gehen werde. Zum einen werde auf jene Autorinnen und Autoren aufmerksam gemacht, die als „zu Unrecht vergessen“ klassifiziert werden können, und sich eben darum der derzeitigen literaturwissenschaftlichen Aufmerksamkeit besonders empfehlen. Zum anderen suche man in den Werken der Namhaften nach bisher übersehenen Aspekten.
Beiläufiger Beginn
Zur Einstimmung präsentiert der Band literarische Kurzprosa: Gedichte und Traumprotokolle, die Elfriede Gerstl 1955 und 1956 in einer Zeitschrift veröffentlicht hat, die ihren Anspruch auf Avanciertheit schon im klein geschriebenen Titel erhob: „neue wege“. Allerdings ist Elfriede Gerstl im eingangs etablierten Schema „zu Unrecht vergessen“ bzw. „berühmt“ nicht leicht unterzubringen. Denn das Werk dieser 2009 verstorbenen Experimentalautorin ist weder gänzlich vergessen noch krisenfest kanonisiert. Diese Zwischenstellung entspricht, so möchte man meinen, sehr genau dem Schreib- und Lebensprogramm der Autorin. Christa Gürtler, eine der Herausgeberinnen einer zurzeit entstehenden Gerstl-Werkausgabe, meint in ihrem Kommentar zu den Texten, die Autorin habe sich stets an die selbst gesetzte Devise gehalten: „alles was man sagen kann, kann man auch beiläufig sagen.“ Mithin ist es nicht verwunderlich, dass Gerstls Werk, wie Gürtler ein wenig vorwurfsvoll anmerkt, „jahrzehntelang im Schatten jener stand und steht, die es verstanden, auf sich aufmerksam zu machen.“ Das Beiseite-Sprechen, das sich vor allem in Kurz- und Kürzestformen artikulierte, ist auf lautstarke Wirkungen nicht angelegt, sondern auf die Zustimmung weniger, aber aufmerksamer Leserinnen und Leser. Ihrer Lektüre empfehlen sich auch die kurzen Texte im „Treibhaus“-Jahrbuch.
Eher Blicke als Überblicke
Auf den originellen Einzelfall folgen nun zwei Überblicksartikel, die das reichhaltige Material perspektivieren. Freilich sind „Überblicke“ in den letzten Jahrzehnten in Verruf geraten. Die „großen Erzählungen“ oder „Master-Narrative“ wurden von französischen Theoretikern, allen voran Jean-François Lyotard, als ideologiehaltige Konstrukte entlarvt, die es zu dekonstruieren gelte. Diesem Imperativ entspricht im „Treibhaus“ Wynfried Kriegleder, der in seinem einführenden Artikel erklärt, es sei nötig, gegen das germanistische „Master-Narrativ“ von der einheitlichen „deutschen Literatur“ „anzuschreiben“. In diesem „Anschreiben“ entsteht dann freilich ein neues Narrativ, ein Überblick der anderen Art.
In den Jahren nach dem katastrophal gescheiterten „Anschluss“ an Deutschland und dem Zweiten Weltkrieg war das österreichische Bestreben nach einer eigenen (und das hieß eben: nicht-deutschen) Kultur und Literatur besonders ausgeprägt. Dennoch steht einem differenzierten Verständnis der damaligen österreichischen Literaturverhältnisse nicht nur die falsche Subsumierung unter Deutschland im Wege, sondern auch der analoge konservative „austriakische Mythos“, den Kriegleder mit einem Zitat Alexander Lernet-Holenias aus dem Jahr 1945 illustriert: „In der Tat brauchen wir nur dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben, in der Tat brauchen wir nicht voraus-, sondern nur zurückzublicken“.
Dieser programmatisch rückwärtsgewandte Satz, der vermutlich nur noch bekannt ist, weil ihn die Literaturwissenschaft immer wieder kritisch heraufbeschwört, wird in beiden Überblicksartikeln zitiert, und das in differierender Bewertung: Kriegleder meint, Lernet-Holenias Vorstellung von Österreich sei „so provinziell nicht“, denn der Autor denke an einen Staat, der „das Prinzip enger Nationalität zugunsten seiner Kultur, seiner Lebensart und seiner politischen Tradition längst aufgehoben hatte und wiederum aufheben wird.“ Mit diesen (seltener zitierten) Worten setzte Lernet seine Ausführungen fort. Der altösterreichisch geprägte Autor spielt hier offensichtlich auf habsburgische Vorstellungen von einer weiträumigen Kulturnation an. Dennoch hat Evelyne Polt-Heinzl wohl auch nicht unrecht, wenn sie in ihrem Überblick Lernets Appell, „dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben“, vor allem als Bemühung um Kontinuität zwischen Austrofaschismus und Zweiter Republik versteht. Ältere Autoren wie Lernet, Rudolf Henz, Max Mell und andere waren in der Zeit des Ständestaats bereits anerkannte Schriftsteller oder gar – wie Henz – Funktionäre. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus musste ihnen daran gelegen sein, die alten Besitzstände zu wahren – was ihnen, wie Polt-Heinzl zeigt, auch bis weit in die sechziger Jahre hinein gelungen ist.
Ein weiteres „Master-Narrativ“ der österreichischen Nachkriegs-Literaturgeschichte besagt daher, dass in den fünfziger Jahren nur Restauration geherrscht habe, bis sich endlich – in der „Wiener Gruppe“ und anderen Formationen – eine junge, radikal avantgardistische Opposition dagegen artikuliert habe. Gegen diese probate Zweiteilung „schreibt“ Polt-Heinzl „an“, indem sie in einer materialreichen Studie darlegt, dass auch in Österreich eine „Trümmerliteratur“ aufzufinden ist, obwohl die Literaturgeschichte diesen Begriff in der Regel für Deutschland reserviert. Allerdings ist es, so Polt-Heinzl, bezeichnend für die österreichischen Literaturverhältnisse, dass die literarischen Versuche, dem Verschweigen von Kriegsverbrechen und Genozid entgegenzuarbeiten, ihrerseits verschwiegen und verdrängt wurden. Felix Hubalek wurde zum Beispiel als Lyriker und Mitherausgeber des „FORVM“ bekannt, sein Roman „Die Ausweisung“ jedoch, der das Leben im „angeschlossenen“ Österreich ungeschönt zeigt, erschien erst 1962. Da war Hubalek schon vier Jahre tot. Und Annemarie Selinko ist zwar bis heute als Verfasserin des Weltbestsellers „Desirée“ ein Begriff, nicht aber als Widerstandskämpferin, die ihre Erinnerungen und Erlebnisse in einem Novellenband beschrieben hat, der, wie Polt-Heinzl schreibt, „bis heute nicht erschienen ist.“
Die Heimat und die Jugend
Das Herumirren zwischen „Restauration und Aufbruch“, das in den beiden Eröffnungsartikeln schon angesprochen wurde, wird in den nun folgenden zwei Beiträgen detaillierter untersucht. Barbara Wiedemann stellt den ersten Jahrgang der Wiener Zeitschrift FORVM vor, und fragt dabei im Besonderen nach der Bedeutung, die der neuen österreichischen Literatur in dieser vorrangig politisch-weltanschaulichen Zeitschrift zugeschrieben wurde. Das FORVM war ein Medium des Kalten Kriegs, das – über den Umweg des „Kongresses für die Freiheit der Kultur“ mit Sitz in Paris – vom CIA finanziell unterstützt wurde. Gründer und Herausgeber der Zeitschrift waren, neben dem bereits erwähnten ehemaligen Widerstandskämpfer Hubalek, der aus der Emigration zurückgekehrte Friedrich Torberg, der in der NS-Zeit nicht nennenswert verfolgte Lernet-Holenia und Friedrich Hansen-Löve, über dessen Verhalten in des NS-Zeit nichts bekannt ist, wie Wiedemann konstatiert. Diese vier sehr unterschiedlichen Intellektuellen schrieben nun der Literatur die Aufgabe zu, „österreichisch“ zu sein, und zwar, wie es in einer merkwürdig gewundenen Formulierung heißt: „österreichisch im besten Sinn, der diesem Wort innewohnen kann (und der ist nicht schlecht)…“.
Wiedemann stellt dar, dass diese Forderung nach Österreich-Spezifik unter anderem dazu führte, dass die neue bundesrepublikanische Literatur im FORYM in der Regel weniger gut beurteilt wurde als die eigene. Der österreichischen wurde – von Torberg, aber auch von Oskar Maurus Fontana und Herbert Eisenreich – eine sicherere Beherrschung der Sprache und ein genaueres Bewusstsein von der literarischen Tradition attestiert. Barbara Wiedemann betrachtet diese Position nicht unkritisch. Zum einen stellt sie fest, dass diese Qualitäten meistens an den Beispielen älterer, längst anerkannter Autoren nachgewiesen wurden: Joseph Roth, Robert Musil, Hermann Broch, Karl Kraus. Zum anderen meint sie in einer ironischen Replik auf einen Aufsatz Herbert Eisenreichs: „Bei genauem Hinsehen gibt es heute keinen Grund, die Romanciers Reinhard Federmann und Paul Schallück oder die Lyriker Herbert Zand und Wolfgang Bächler qualitativ so gegeneinander auszuspielen, wie Eisenreich das tut.“ Bange Frage: Wer kennt die genannten Autoren heute noch gut genug, um diese Aussage überprüfen zu können? Wahrscheinlich kaum jemand – womit gesagt sein soll, dass „die Literatur der fünfziger Jahre“ in Österreich wie in Deutschland mittlerweile eine weitgehend historisch gewordene Formation geworden ist.
Am Beginn dieser Literaturentwicklung, die wir von heute aus als unsere Vergangenheit wahrnehmen, stand in Österreich die Proklamation einer „Generation der 45er“, deren Besonderheiten Natalia Bakshi nachgeht. Wie bei emphatischen Generationsbündnissen meistens, bestand auch hier ein „Vereinigungsimpuls ohne einen bestimmten Fokus“ (Bakshi), d.h. dass alle politischen, weltanschaulichen und ästhetischen Gegensätze dem Willen zur Gemeinsamkeit untergeordnet wurden. Schließlich hatten alle denselben Krieg überlebt – wenn auch auf unterschiedliche Weise! – und alle waren entschlossen, mehr in die Zukunft als in die Vergangenheit zu schauen. Darin unterschieden sich die Jungen von Konservativen wie Lernet-Holenia. Die Bühne für diesen Generationsauftritt boten mehrere Anthologien, die in ihren Titeln entweder das Junge („Stimmen der Gegenwart“, „Reifende Saat“) oder das Verbindende betonten („Die Sammlung“, „Tür an Tür“.) Natalia Bakshi zitiert und kommentiert eine Reihe von Texten, die bei allen Unterschieden eine gewisse religiöse Gestimmtheit, eine Evokation des Leidens und der Schuld und die vage Hoffnung auf eine bessere Zukunft gemeinsam haben. Freilich hatte all das einen starken Appellcharakter, was Bakshi einleuchtend darauf zurückführt, dass diese „Generation der 45er“ eher ein literaturpolitisches Wunschbild als eine tatsächlich vorhandene Gruppierung gewesen ist. Schon in der Mitte der fünfziger Jahre verschwand dieser Anfangsimpuls, und die politischen und literarischen Differenzen traten stärker hervor als die erstrebten generationellen Gemeinsamkeiten.
Erzählungen und andere Prosa
Nachdem in vier Aufsätzen die Grundlagen gelegt sind, wendet sich das Jahrbuch in neun Einzelstudien jenen Autorinnen und Autoren zu, deren Werke komplex genug sind, um die widersprüchlichen Kräfte und Tendenzen der Zeit in sich zu bündeln und – oft genug inkonsistent – zu verarbeiten. Dabei werden zunächst „Neue Ansätze des Erzählens“, und danach die „Arbeit an der Lyrik“ untersucht, wobei Werke mit stark divergierenden ideologischen und ästhetischen Voraussetzungen nebeneinander gestellt werden – was der Unentschiedenheit dieser Epoche besser gerecht wird als allzu stringente Thesen oder Synthesen.
Der erste Autor, der in der „Erzähl“-Rubrik vorgestellt wird, ist genau besehen alles andere als ein Erzähler: Ernst Fischer, der 1945 aus dem Moskauer Exil nach Österreich zurückgekehrt ist, und als Kommunist am demokratischen Aufbau des neuen Österreich mitwirkte, war Politiker, politischer Theoretiker und Literat, der sein Schreiben als Mittel im politischen Kampf einsetzte. Jürgen Egyptien analysiert die Bedeutung der Literatur in Fischers Denken und kommt zu dem Schluss, der marxistische Theoretiker habe nicht zuletzt mithilfe der Literatur eine „Entdogmatisierung“ seiner politischen Positionen erreicht. Fischers Drama „Der große Verrat“ (1950), das sich in leicht zu entschlüsselnder Form mit Jugoslawien und Josip Broz Tito auseinandersetzt, entspricht noch völlig der stalinistischen Haltung und brandmarkt den Diktator Malabranca (alias Tito) als einen zynischen Verräter kommunistischer Ideale. Später hat sich Fischer von diesem Drama distanziert und sowohl der Kunst als auch der politischen Theorie großzügigere individuelle Freiräume zugestanden.
Unter dem Titel „Unbehagliche Perspektiven“ ruft Sabine Müller dann den Romancier George Saiko und dessen Roman „Der Mann im Schilf“ (1955) in Erinnerung. In einer gründlichen Interpretation erklärt Müller, dass der wissenschaftlich geschulte Autor eine anspruchsvolle sozialpsychologische Theorie der Recht- oder Unrechtmäßigkeit politischer „Führer“ entwickelt hat. Darüber hinaus zeigt sie, dass Saikos literarische Techniken von den Vorgaben der internationalen Moderne inspiriert sind, und doch zugleich eine Distanz dazu artikulieren. Müller zufolge hat Saiko versucht, die vielstimmigen, surrealen Elemente der modernen Romanprosa einzusetzen, ohne dabei dem inhärenten Relativismus dieser Verfahren anheimzufallen. Sie deutet Saikos Schreiben, das er selbst als „magischen Realismus“ bezeichnet hat, als eine „formal anspruchsvolle Ausgleichsbewegung“ zwischen „Pluralismus und Wahrheit, Offenheit und Schließung“.
Bei Thomas Bernhard, dem Autor, der im nächsten Aufsatz behandelt wird, kann von irgendwie gearteten „Ausgleichsbewegungen“ keine Rede sein. Elias Zimmermann untersucht die Rolle des Hauses und des Bauens in Bernhards Prosa und in seiner Selbststilisierung als Autor. In seinen jungen Jahren, in denen er noch nicht in der Lage war, alte Vierkanthöfe zu erwerben, schrieb Bernhard eine Reihe von architekturkritischen Feuilletons, in denen er für das traditionelle und gegen das moderne Bauen plädierte. Zimmermann legt nahe, dass Bernhard damals noch stark von kulturkonservativen Positionen wie Hans Sedlmayrs „Verlust der Mitte“ beeindruckt gewesen ist. Nachdem er sich jedoch zum mehrfachen Besitzer traditionell schöner Häuser gewandelt hatte, beschrieb er in seinem Roman „Korrektur“ den Wissenschaftler Roithamer, der ein nie dagewesenes Haus in Form eines Kegels bauen möchte – ein genuin modernes Projekt, auch wenn es scheitert. Mithilfe derartiger Beobachtungen kommt Zimmermann zu dem autortypologisch interessanten Schluss, dass Leben und Werk bei Bernhard einander nicht bedingen, sondern in einer gegenläufigen Bewegung auseinanderstreben. Die öffentlich zelebrierte Lebensform bleibt den Idealvorstellungen der fünfziger Jahre treuer als die Struktur der literarischen Texte.
Auch in der nun folgenden erzähl- und gendertheoretischen Studie geht es um Raum-, Haus- und Bau-Metaphern: Laura Schütz untersucht die frühe Prosa Marlen Haushofers unter dem bewusst doppeldeutigen Titel „Vor der Wand„. 47 Erzählungen unterschiedlicher Qualität und Ambition hat Haushofer zwischen 1947 und 1957 verfasst, und Schütz verfolgt in diesen Texten die Entstehung jener Metapher, die 1963 in Haushofers Roman „Die Wand“ erst ihre volle Bedeutung entfaltet. Wände haben in Haushofers früheren Texten eine ambivalente Funktion: Sie schirmen die weiblichen Figuren vor der bedrohlichen Außenwelt ab, verhindern aber zugleich deren intellektuelle Entwicklung. Sie gehören dem Haus an, das wiederum auf dem Land verortet wird, während in der Stadt die Möglichkeiten eines offenen, aber in der Sprache der fünfziger Jahre gesagt: auch „unbehausten“ Lebens zur Verfügung stehen. Das entscheidende Handlungselement in Haushofers Prosa ist jedoch nach Schütz die Durchdringung aller Wände, die in einer patriarchalisch verfassten Gesellschaft den Frauen im Wege stehen. Und da diese „performative“ Geste so eindringlich gelungen ist, können heutige Leserinnen – so Schütz – nichts mehr anfangen mit den „absoluten essentialistischen Geschlechterdichotomien“, zu deren Beschreibung und Überwindung Haushofer gleichermaßen beitrug.
Der Autor, der das Kapitel „Neue Ansätze des Erzählens“ abschließt, eröffnet zugleich einen Ausblick auf die danach folgende Lyrik-Abteilung. Denn der Wiener Avantgardist René Altmann, dessen Produktion von Thomas Keith unter dem Leitbegriff der „poetischen Reduktion“ vorgestellt wird, schrieb Texte, die irgendwo zwischen Lyrik, Kurzprosa und Mikrodrama angesiedelt waren. Keith zeigt sehr einleuchtend, dass in Altmanns Schreiben eine Tendenz zur Verknappung wirksam war, die den Autor zunächst an den Rand des Verstummens führte, wo er nur noch Chiffren wie „La. La. La“ oder „A 61 563“ notierte, bis er schließlich ganz zu schreiben aufhörte. Auf dem Weg hin zu diesem erwartbaren Ende gelangen ihm allerdings frappierende Texte, die heute moderner anmuten als die Dramen Ernst Fischers oder die Erzählungen Marlen Haushofers.
Gedichte und Philosopheme
Der Lyrikteil erinnert zunächst an eine Autorin, die – wie Elfriede Gerstl – weder vollkommen vergessen noch allseits bekannt ist: Hertha Kräftner, die sich 1951 im Alter von 23 Jahren das Leben genommen hat. Ihr schmales lyrisches Werk, das 2001 unter dem Titel „Kühle Sterne“ von Gerhard Altmann und Max Blaeulich herausgegeben wurde, wird meist als Dokument eines tragisch gescheiterten Lebensentwurfs gelesen. In seiner literaturwissenschaftlichen Werkanalyse rettet Matthias Berning Kräftners Kunst vor dem bloß biographischen Interesse an Lebens- und Sterbensumständen. Ausgehend von Kräftners Satz „Jedes Seelenbild ist auch ein Weltbild“ untersucht er die reichlich vorhandenen intertextuellen Bezüge in Kräftners Lyrik, zeigt aber zugleich auch, dass die scheinbar so subjektiven Gedichte dieser jungen Lyrikerin repräsentativ sind für das Denken und Schreiben einer ganzen Generation. Er schließt sich all jenen an, die Kräftner als gleichwertige Autorin neben die berühmtere Ingeborg Bachmann stellen wollen.
Dennoch wird Bachmann auch im „Treibhaus“ weiter oben auf der impliziten Ranking-Liste platziert als Kräftner. Diese unstrittig berühmte Dichterin ist nämlich die einzige, deren Werk in diesem Band in zwei Aufsätzen bedacht wird. Im ersten Beitrag vergleicht Erik Schilling Bachmanns Hymne „An die Sonne“ mit Giuseppe Ungarettis Gedicht „Finale“, das Bachmann ins Deutsche übersetzt hat. Beide Gedichte besingen eine Naturgewalt, Bachmann die Sonne, Ungaretti das Meer. Beide artikulieren jedoch mit unterschiedlichen Mitteln die spätzeitliche Empfindung, das lyrische Sprechen über erhabene Gegenstände wie Sonne und Meer könne nur noch in gefährdeten Formen gelingen. Aber gerade dieses Gefährdungs-Bewusstsein ermöglicht eine neuartige hymnische Feierlichkeit. Schilling bezeichnet diesen prekären Status der dichterischen Sprache mit einem Terminus der Ritualforschung als „liminal“, womit ein „Zwischenstadium“ bezeichnet ist, dessen Besonderheit darin besteht, „dass es Elemente sowohl des vorangegangenen als auch des folgenden Zustands umfasst, diese aber jeweils nicht fixiert sind.“ Eben dies ließe sich mutatis mutandis für große Teile der Literatur behaupten, die in diesem „treibhaus“-Band behandelt wird.
Ingeborg Bachmann wurde 1949 an der Universität Wien mit einer philosophischen Dissertation über Martin Heidegger promoviert. Walter Kühn geht im zweiten Bachmann-Artikel den Interdependenzen und Widersprüchen nach, die zwischen Bachmanns wissenschaftlicher Heidegger-Kritik und ihrer literarischen Beschäftigung mit dem Werk des deutschen Philosophen bestehen. Kurzgefasst lässt sich sagen: Die Philosophin Bachmann ist mit Heideggers Metaphysik, die ihn an die Seite der Nationalsozialisten getrieben hatte, und die sie ausdrücklich als „gefährlich“ bezeichnet, kritischer als die Dichterin gleichen Namens. Diese ist für Heideggers Bedenken des Todes und der Grenzen menschlicher Allmacht ebenso empfänglich wie für einige Besonderheiten seiner Sprache. So teilte die junge Ingeborg Bachmann Heideggers Vorliebe für „durch Bindestriche verbundene Wortildungen“ und schrieb etwa in einem Gedicht mit dem geradezu haushoferschen Titel „Hinter der Wand“: „Ich bin das Immerzu-ans-Sterben-Denken“.
Als letzter Autor wird Paul Celan betrachtet, dessen Zugehörigkeit zur österreichischen Literatur weder ganz gesichert noch völlig unbeweisbar ist. Auch Celan unterhielt, wie Nadja Reinhard darstellt, eine tief ambivalente Beziehung zu Martin Heideggers Philosophie. Einerseits beschäftigte er sich intensiv mit dessen Denken und war durchaus einverstanden mit Sätzen wie „Gedächtnis, das gesammelte Andenken an das Zu-Denkende, ist der Quellgrund des Dichtens“. Andererseits billigte er dem Philosophen, der seine begeisterte Parteinahme für Hitler nach 1945 niemals erklärt oder gar bedauert hat, keine mildernden Umstände zu. 1959 wurde Celan gebeten, einen Text für die Festschrift zu Heideggers 70. Geburtstag zu liefern. Er lehnte dieses Ansinnen ab, in Übereinstimmung mit seiner Freundin Ingeborg Bachmann, die ebenfalls um eine Mitarbeit gebeten worden war, sie aber genauso verweigerte.
Damit sind alle 14 Beiträge dieses durchwegs studierenswerten Sammelbandes in der Ausführlichkeit vorgestellt, die sie verdienen. Sie sind allesamt auf neuestem literaturwissenschaftlichem Stand und überzeugen mit gründlicher Materialkenntnis. Da sie sich auf unterschiedlichen methodischen Wegen verschiedensten Fragestellungen nähern, entsteht kein homogenisiertes „Master-Narrativ“ über die fünfziger Jahre in Österreich, sondern eher ein Flickenteppich oder Patchwork. Doch erweist sich im Lauf der Lektüre, dass gerade diese inhomogene Gesamtanlage der Widersprüchlichkeit, Unentschiedenheit und Vielgestaltigkeit der beschriebenen Epoche besonders gut entspricht.