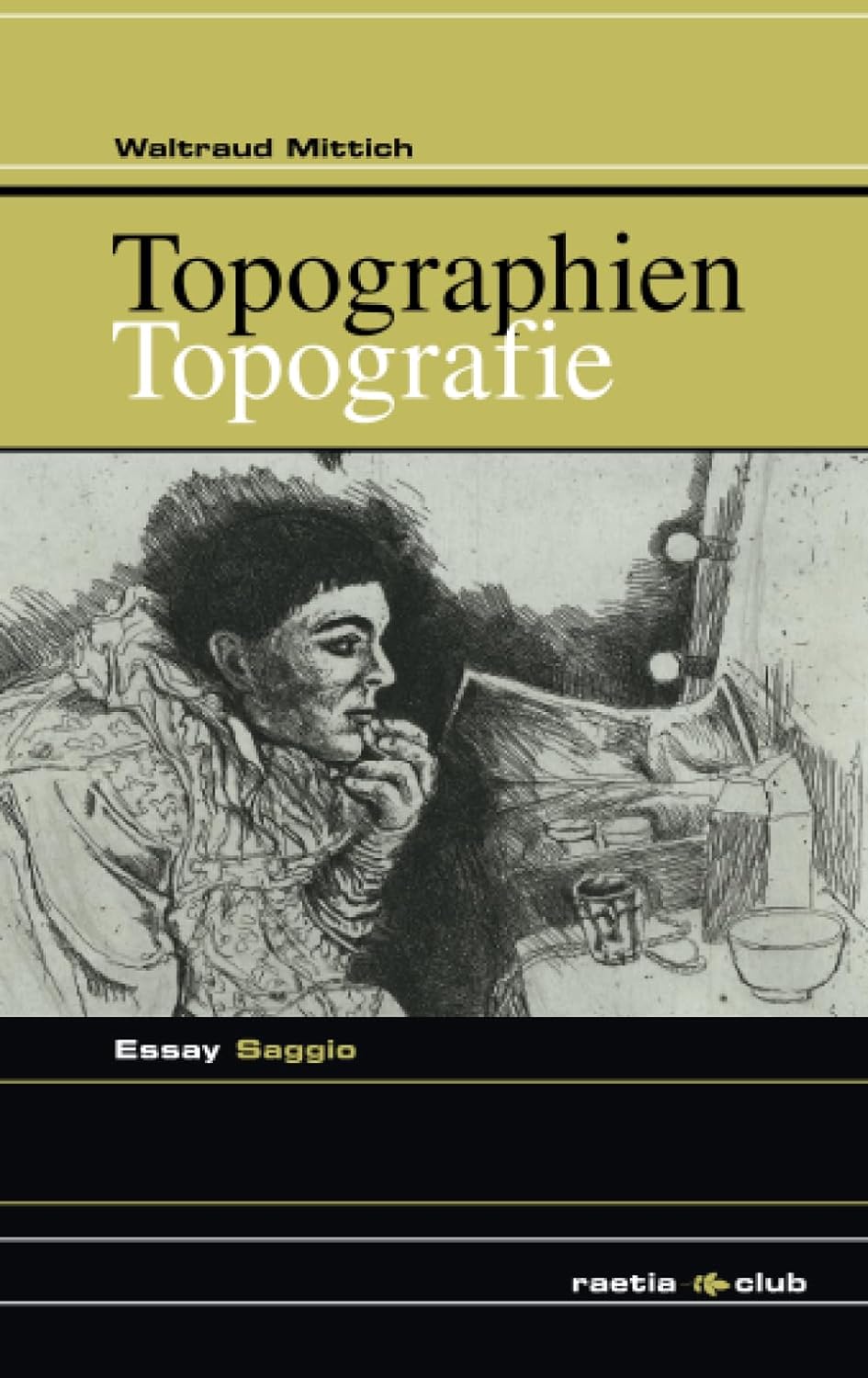Das Mittich-Ich befindet sich in Berlin, auf der Suche nach der Klärung des Verhältnisses zur deutschen Sprache und Literatur, das die Autorin Mittich, eine deutschsprechende Südtitolerin mit italienischem Pass, immer als „eine Art Feindschaft“, aber auch als ein „Liebesverhältnis“ erlebt habe. (16). Das Verhältnis klären will die Autorin auch zu Südtirol selbst, zu den Südtirol-Deutschen. Nachgedacht wird über das Deutschsein in der südtiroler Enklave, dem „Durchzugsland für flüchtige Naziverbrecher“, die „heimgeführt“ hatten werden wollen, „ins Reich“ (22).
Dicht gedrängt finden sich im Text Autoren und Autorinnen, die Waltraud Mittich auf die eine oder andere Art begleiteten, berührten, auf-regten: E.T.A. Hoffmann, Dostojewski, Döblin mit seinem Franz Biberkopf aus Berlin Alexanderplatz, Günter Grass, Tieck, Eichendorff, Marisa Fenoglio, Claudio Magris, Elsa Morante oder „Sie, die Österreicherin, die Berühmte, die Schöne, sie an der ich nie vorbeikomme, wenn ich schreibend unterwegs bin“ – Ingeborg Bachmann, deren Berlin-Essay eine Folie für Mittichs Essay über das Deutsch-(Nicht-)Sein geboten zu haben scheint. Mit Bachmanns Versen wie mit „Sterbenssakramenten““versehen“ bewegt sich das Ich – physisch, lesend, schreibend – durch jenes Berlin, das Zentrum und Ausgangspunkt grauenvoller Vernichtungspolitik war, und stellt durch bzw. mittels Ingeborg Bachmanns „Betrachtungen“ fest: „Die Stadt Berlin wird für die Österreicherin Schauplatz des Gedächtnisses. An Krieg und Nazismus, Shoah und Exil des jüdischen Volkes.“ (80)
Gesucht wird nicht nur nach einer Klärung des Verhältnisses zum Deutschsein oder „Deutschtum“, sondern auch des Verhältnisses Deutsch-Italienisch – eine von vielerlei Klischees, Alltagssehnsüchten und literarischem Klimbim geprägte Beziehung, durchmischt noch durch die Spezifizierung des „Deutschen“, durch etwas – bloß was genau? – Österreichisches daran.
Da ist also, neben Berlin und Deutschland, „Italien, das Sehnsuchtsland, Rom, die Stadt der Begierde“ (16) – von Massen von deutschen Touristen sicherlich anders erlebt als von der Autorin selbst, der Südtirolerin, die in Padua ihr Literaturstudium absolvierte. Italien wurde aber auch erlebt vom im Essay zitierten Hoffmann, mit seiner „tödlichen Sehnsucht nach Italien, ein Land, das er niemals sehen würde“, oder von Heine mit seiner „Hassliebe“, von Goethe mit seinem „Unglücklichsein in diesem Land“ (20). So heißt es etwa: „Es ist die deutsche Melancholie, die sizilianische Sehnsucht nach Unbeweglichkeit und Vergessen, das immer zudringlichere Bewusstsein bei beiden. Der tiefe Süden. Hier, jetzt und früher.“ (54) Mittichs Suche nach dem Deutschsein ist also gekoppelt an die Liebe zu Italien.
Der Text ist wohl kaum zufällig strukturiert durch die wiederkehrende Nennung eines ganz bestimmten italienischen Textes, des „Gattopardo“-Themas, dem das Mittich-Ich nachspürt. Ein anderer Knotenpunkt und mythischer Ort ist Kaliningrad als der „letzte und erste Ort“, mit dem „die Jugend zu Ende“ war. Das Ich verbleibt atemlos bis zum Ablesen dieses Ankunftsortes auf der Anzeigentafel auf dem Bahnhof Lichtenberg – dieses Ablesen will es als Bestätigung dafür annehmen, „dass das Wirkliche nur im Schriftlichen aufleuchten konnte, manchmal.“ (34)
Auch reflektiert dieses Mittich-Ich, dass es immer schon „Bücher und Namen und Plätze“ waren, die ihm den „Kopf verdreht haben“ (10), weshalb es nun auf den Spuren des „Sounds“, der die Autorin seit ihrer Jugend begleitet hatte, wandelt. Plätze sind – „kopfverdrehende Zumutungen, lebenslang“ (14), gesteht sich das Ich ein, so wie die Tatsache, dass es immer schon Namen gewesen waren, die es eingenommen haben wie Feldherren Schlösser oder Städte oder Länder.
So stapelt das Ich „Wirklichkeits-, Realitätsschichten übereinander“ und erfasst imaginäre Topographien, so schlängelt sich der in beschwörender Prosa erzählte Wanderweg durch „aufgelassene Welten, zweigleisige Welten“ (56), verweilt an Schauplätzen literarischer und historischer Natur, führt durch „deutsche“, „italienische“, „österreichische“ und „russische“ Welten (siehe Leseprobe).