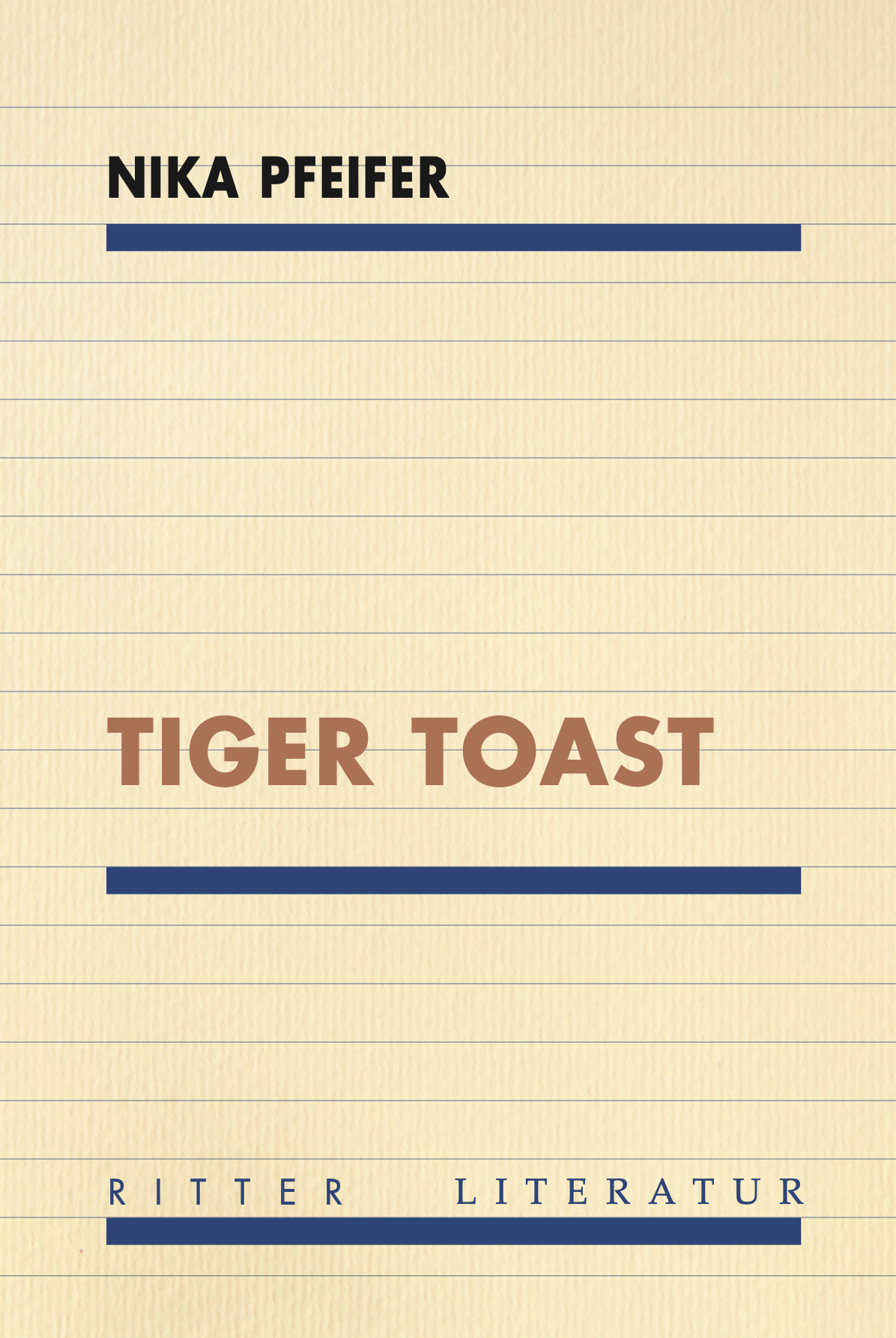TIGER TOAST ist ein konzeptuelles wie intermediales Gesamtkunstwerk. Sämtliche Gedichte sind klein geschrieben, die Titel groß, es gibt verschiedene Schriftarten, fett und kursiv, mit und ohne Serifen, verschiedene Schriftgrößen – und Illustrationen, die den Band durchziehen und auf den Tiger verweisen. Es finden sich Handlungs- und Regieanweisungen sowie eine Performance, und es werden alte Texte (und Fotografien) interpretiert. Das namensgebende Gedicht TOAST ist in der Buchmitte platziert: „wir tranken wodka / aufs leben auf die liebe usw. / dann küssten wir uns / du wie ein tiger & ich / fragte mich / wie küssen denn die“ (S. 38).
Nika Pfeifer bringt Feststellungen, Bemerkungen, Behauptungen, in kurzer und knapper Form, spielt mit Dreizeilern, entwirft Gedichte wie Farbspritzer, die in ihrer Dichte, Zahl und Mannigfaltigkeit ein reiches, kosmopolitisches, weltumspannendes Werk darstellen. Die Autorin wechselt von Laut- und Sprachmalerei zu Sprachmagie und -wissenschaft, und bewegt sich auf all diesen Terrains mit Leichtigkeit, wechselt mühelos von einer Sprache in die andere, vom österreichischen Dialekt zu Englisch, Französisch. Sie bewegt sich mit Sprache und Geist in vielen Kulturen: „langue long lang / long itude etude / meh tude me tong / me tongue’n’cheek / speak’n all-tongue / tray chic!” (S. 17)
Pfeifer zu lesen, ist ein Genuss, lustvoll nutzt sie die Mehrdeutigkeit der deutschen Sprache, kommentiert ihr eigenes Schreiben, ihre Sprache ist intuitiv-assoziativ, philosophisch-reflexiv. Und immer wieder schimmert ihr feiner Humor durch: „addendum: / zuerst ist der wortstrudel in der dichterin / dann ist die dichterin im wortstrudel“ (S. 15).
Häufig verweist Pfeifer auf Kolleg:innen, andere Dichter:innen, Musiker:innen, verbeugt sich, verehrt – durch die Kürzel „head-bow“, also Verneigung, oder „hat-tip“, also Anheben des sprichwörtlichen Hutes –, referenziert, lässt sich von Gedanken und Bildern inspirieren, anstupsen, beeinflussen, macht sich diese (fremden Worte) zu eigen und erschafft daraus Neues. Sie verwendet Zitate als Anlass- und Ausgangspunkte, verbindet alle und alles miteinander. Pfeifer hat keine Angst vor der Verbindung, der Verbindlichkeit: „leave the capsule if you dare / david bowie” (S. 15).
Die Autorin nähert sich Themen und Ideen von allen Seiten und mit allen Sprach-Möglichkeiten an, ihr Denk-Horizont ist ein weiter, das spürt man in den Texten. Pfeifer reflektiert die Position von Menschen und anderen im Raum, Leben, Sein, und öffnet Fenster und Türen zu neuen Welten, stellt Fragen an die Lesenden.
An manchen Stellen erläutert oder erklärt sie Sachverhalte, Wörter oder Ideen. Sie wechselt von Beobachtungen: „der fliege den ausweg zeigen: / wie exakt denken / am rande des untergangs“ (S. 26) in eine überplanetarische Perspektive, führt einen Dialog mit der Erde selbst: „dear world, gab es je eine zeit / wo’s nirgends krieg gab? / uh yeah but no but yeah but / auch wenn nur für einige wenige tage? / yeah but no but yeah but no but yeah / but maybe in ancient civilisations“ (S. 12).
In TIGER TOAST tauchen verschiedene Wirklichkeitsebenen auf, etwa Träume und Geheimsprachen, die Pfeifer an eine körperliche Wirklichkeit bindet und damit erdet. Diese Körperlichkeit spannt den Bogen zum Geist, zur Sprache:
„den bleistift ins gedicht geholt
stolpere ich
über ein kratzen auf papier in der stille
wörtlich übersetzt ergibt es / das kratzen / keinen sinn
doch es wird eine neue spur gelegt in meinem ohr
die mich weiter führt von hier
sie lädt dazu ein getragen zu werden
von sprache zu sprache
von körper zu körper
alles war hier vernommen wird =
vorläufiges & vergangenes
etwas demnächst zu entstehendes
[musik]
[musik]“ (S. 60)
Thematisch ist der Band breit gefächert, befasst sich mit Reisen, Beziehungen, Musik, Philosophie, einige wenige Gedichte nähern sich eher Emotionen als Gedanken an und erzeugen damit eine andere Art von Tiefe. Pfeifer scheut sich aber auch nicht davor, politisch zu sein, geht beispielsweise auf die unterschiedliche Sprachmächtigkeit von Menschen ein, wie im Stück PERFORMANCE (S. 71), in dem sie auf den Klassiker Can the subaltern speak (1988) der indisch-amerikanischen Literaturwissenschaftlerin Gayatri Spivak verweist.
Nika Pfeifers Gedichte sind kleine Talismane, die man wiederfinden, wieder lesen, wieder entdecken möchte (und kann), in einem Lesen oder indem man dem Überraschungsmoment Raum gibt, und das Buch immer wieder einfach aufschlägt.
Auf S. 57 schreibt die Autorin: „dort / wo das wort sich in beziehung setzt / ist man aufgehoben // wenn auch nicht gerettet“. In diesem einen Fall möchte man ihr nicht zustimmen: Wo Nika Pfeifer Worte in Beziehung setzt, fühlt man sich nicht nur aufgehoben, sondern verstanden, abgeholt, verbunden, berührt und ist in diesem Sinne, durchaus gerettet.
Marianne Jungmaier, geb. 1985, studierte Digitales Fernsehen, Medien- und Kulturwissenschaften (B.A.) und Journalismus (M.A.). Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt der Lyrikband Gesang eines womöglich ausgestorbenen Wesens (Otto Müller, 2024). Homepage von Marianne Jungmaier