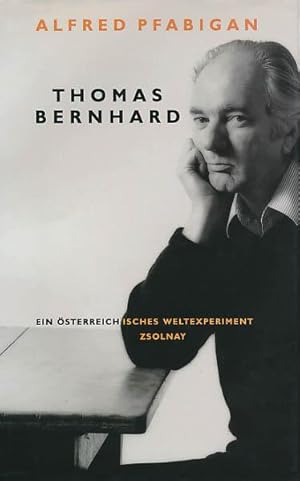Diese Provokation hat plangemäß die Literaturwissenschaftler auf eben diesen gerufen. Wendelin Schmidt-Dengler bemängelt in der „Presse“, daß die Kritik an der Forschung „diffus“ bleibe, weil vorliegende Arbeiten ignoriert würden, und Ulrich Weinzierl attestiert Pfabigans Literaturverzeichnis in der FAZ „Mut zur Lücke“. Tatsächlich fehlt darin nicht nur Schmidt-Denglers wichtige Aufsatzsammlung „Der Übertreibungskünstler“, es fehlen auch zentrale Monographien: Hier geht es nicht bloß um akademische Courtoisie, sondern um Information für den Leser – einem Dissertanten ließe man so etwas nicht durchgehen. Freilich dürfte manches einfach passiert sein: Jedenfalls dreimal wird auf Titel verwiesen, die im Verzeichnis nicht zu finden sind. Nur mit großem Zeitdruck sind auch die Schreibfehler und sprachlichen Ungereimtheiten zu erklären.
Diesem philologischen Kleinzeug zum Trotz erweist es sich als durchaus gewinnbringend, daß hier einer im Revier der Germanistik wildert. Alfred Pfabigan agiert allerdings weniger als Philosoph denn als Psychoanalytiker. Wenn Bernhard einen Denker schreibend verinnerlicht hat, war es wohl Nietzsche. Schopenhauer, Montaigne und Pascal auf der einen, Heidegger auf der anderen Seite wurden von ihm ja mehr beschworen als erfaßt, sie waren Spielgeld und Accessoires der „Geistesmenschen“ oder der „Stumpfsinnigen“ wie der italienische Anzug oder die Pumphose. Der Tiefenpsychologe wird in Bernhards Büchern schon eher fündig: Pfabigan deutet die Prosa von „Frost“ (1963) bis „Auslöschung“ (1986) als einen in mehreren Anläufen und auf Umwegen unternommenen Versuch, „die richtigen Fragen zu stellen“, den Grund der eigenen Verwundung in der Familiengeschichte zu entdecken und eine ars vivendi zu entwickeln: eine Art Erkenntnis-Evolution also. Gegenüber dem, was die Figuren apodiktisch in die Welt hinausposaunen, scheint Skepsis angebracht: Hier werden auch ihre Schwächen mit prächtigen Monologkostümen bemäntelt, hier spricht nicht einfach ihr Autor. Schließlich warnt auch der Ich-Erzähler der „Auslöschung“ davor, „Unwahrheiten und Falschheiten“ für authentisch zu halten, nur weil ein „überzeugender Mensch“ sie sagt.
Weil Pfabigan seine Sinne an freudianischen Konstellationen geschärft hat, untersucht er scharfsinnig nicht nur den offenkundigen Frauenhaß, sondern auch die versteckte „sexualisierte Privatsprache“ in diesen Texten: von dem verdächtigen Weinflaschenstöpsel bis zur Zuckerzange, die irgendwo gar zur „Zuckerstange“ mutiert! Daß der Ich-Erzähler in „Holzfällen“ von einer homosexuellen Verführung durch seinen einstigen Gönner Auersberger berichtet, kann jeder nachlesen. Daß aber der Titel nicht bloß Assoziationen zu jener Axt im Walde erlaubt, als die Bernhard in diesem Schlüsselroman gegen seine Freunde gewütet hat, sondern eine bereits in „Amras“ begründete Metapher für praktizierte Männerliebe ist, sagt uns erst Pfabigan. „Holzfällen“ als Outing des Thomas Bernhard? Dessen Biographisches könnte zu einer billigen Popularseelenkunde verführen: das uneheliche Kind, das unter der Abwesenheit der Mutter und dem Verschwinden des niegekannten Vaters leidet und im Großvater, dem Heimatdichter Johannes Freumbichler, den Ersatzvater findet. Pfabigan erliegt dieser Gefahr nicht, eher wird er manchmal zu originell, wenn er etwa die zum Trocknen aufgehängten Leintücher des bettnässenden kleinen Thomas in den weißen Burgtheater-Plakaten des Claus Peymann wiederzuerkennen glaubt: Es gibt also auch eine psychoanalytische Verfremdung.
Rückt Pfabigan hier die „Ästhetik ins Zentrum der Betrachtung“ (Konrad Paul Liessmann)? Nicht wirklich. Er liest Bernhards Geschichten-Trümmer auf und setzt sie für seine Zwecke neu zusammen, dem „Baukastenprinzip“ des Oeuvres nachspürend, die Unterschiede im Verwandten suchend. Dabei geht er freilich minutiös und bedächtig vor und liest den Text sehr genau. Wer sich „rauschhaft“ der Bernhardschen Sprachmusik hingibt, gilt ihm schlicht als dumm. Das Dionysische verwirrt allemal die schöne Ordnung. Apropos Ordnung: Die Einteilung des Werks in zwei Blöcke, einen „apollinischen“ und einen „chthonischen“ (bei Nietzsche „dionysischen“), hat einiges für sich, die beiden Gegenwelten drängen sich auf: Da ist, vor allem im Frühwerk, die mörderische Macht der Natur, des Erdhaften, des Geschlechts, der Mutter, der Familie, die den Helden, der nicht weggeht, mit einem riesigen Erbe zu vernichten droht, dort der sich über alles erhebende autonome „Geistesmensch“. Pfabigan bezeichnet Protagonisten wie Paul Wittgenstein in „Wittgensteins Neffe“ und den unglücklichen Glenn Gould-Verehrer Wertheimer in „Der Untergeher“ als „fragmentierte Geistesmenschen“, weil sie den Absolutismus zu weit treiben und dem „Apollinischen Wahn“ erliegen. Das erscheint jedoch als contradictio in se: Der Wahn gehört zur Sphäre des Dionysos, das Apollinische setzt „maßvolle Begrenzung“ (Nietzsche) voraus. Der größenwahnsinnige „Geistesmensch“ ist von Anfang an nicht die Lösung, sondern das Problem, er ist immer „fragmentiert“ und im Grunde nur dort, wo er seinen Perfektionismus aufgibt – wie der Musikwissenschaftler Reger in „Alte Meister“ – überlebensfähig.
Pfabigan sieht in diesem Roman denn auch das „Meisterwerk“ des apollinischen, in „Auslöschung“ das „Meisterwerk“ des chthonischen Blocks, wiewohl darin ja auch ein Erbe eine (italienische) Gegen-Geistesexistenz aufbaut: Lebensgeschichte als erfolgreiche Liquidation einer Erblast, als geistige Konkursabwicklung, die Kindheitshölle und Geschichtshypothek zur Zeit der Waldheimdebatte gleich in einem erledigt: Murau schenkt Wolfsegg „und alles Dazugehörende“ der Israelitischen Kultusgemeinde. (Das Erb-Schloß als Haus Österreich bei Gütersloh und Fritsch im Vergleich wäre vielleicht doch ein Fall für die Germanistik.) Die Lösung also? Leider stößt Murau auf den letzten Romanseiten vieles zuvor Behauptete um und stirbt bald nach der Niederschrift – durch Selbstmord? „Kein Aufgeschriebenes stimmt“, heißt es zur Warnung schon in „Frost“. In der Bewertung des „Gesamttextes“ („Gesamtprosa“ wäre treffender, weil Dramatik und Lyrik weitgehend fehlen) erliegt Pfabigan selbst den Verlockungen des hierarchischen Denkens à la Bernhard: Der „triumphale Höhepunkt“ der „Auslöschung“ verdankt sich nicht ästhetischen, sondern therapeutischen und lebensphilosophischen Gesichtspunkten: Der Fortschrittsgedanke hat in der Literatur zu Recht das Odium der Klassizität. Meisterwerke können auch vom Scheitern handeln. Und nach welchen Kriterien ist die dickleibige „Auslöschung“ meisterhafter als etwa „Wittgensteins Neffe“?
Das Drama „Heldenplatz“ beleuchtet Pfabigan schließlich, um an einem politischen Skandalstück die gewonnenen Erkenntnisse subtil zu erproben: Dieses Land krankt an seiner Geschichte, aber auch die Emigranten-Familie Schuster hat ihre (familiäre) Leidensgeschichte und spricht pathologisch. Hier liegt sehr wohl jener „Erkenntnisgewinn“, den Sigrid Löffler dem „Literatur-Amateur“ in der „Zeit“ kurzerhand abspricht. Der haßliebende Patriot, der reaktionäre Anarchist und Sozifresser, der großbürgerliche Poseur und Bauernbündler, der als Vergangenheitsbewältiger quasi auf die andere Seite gerät, sind uns wiederum so neu nicht – und auch der konservative Grüne Bernhard hätte eigentlich längst allenthalben entdeckt werden müssen.
Dem „Bernhard-Konformismus“ vom ewigen Unterganghofer, auch der „Ein-Buch-These“ (Pfabigan) sonst so kompetenter Kritiker wie Sigrid Löffler und Edwin Hartl, ist der Autor jedenfalls erfolgreich entgegengetreten. Er mag in vielem die eigene Lektüre bestätigen (schließlich hat man sich jeweils auf den „neuen Bernhard“ gefreut, und nicht auf den ewiggleichen), aber er provoziert auch, auf höchstem Niveau, neuen Widerspruch. Daß Bernhard zum Beispiel witzig ist, entspringt gewiß nicht kollektiver Einbildung, und daß er beim Schreiben von „Frost“ gelacht haben „will“, darf man ihm ausnahmsweise glauben. Zu Regers Selbstdefinition, ein „Umblätterer“, kein Leser zu sein, meint Pfabigan, dies sei wohl „ein schmutziges kleines Geheimnis vieler professioneller Leser.“ Seine monumentale und bisweilen weitschweifige Studie, die er im Unterschied zu zahlreichen Bernhard-Figuren auch fertiggebracht hat, erschließt sich in ihrer spröden Besessenheit nur bei wirklichem Lesen: Dann aber ist sie faszinierend.