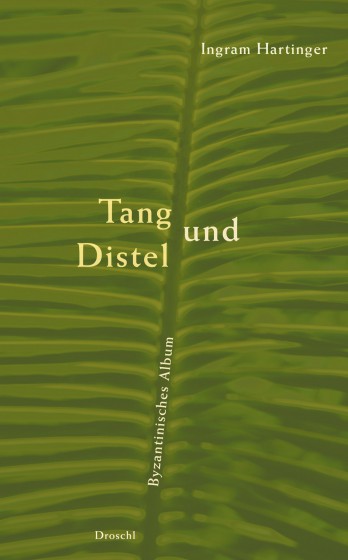Nein, Ingram Hartinger käme wohl niemals in die Verlegenheit, das abertausendste Rosensonett zu schreiben. Nicht ein Autor, der sein Schreiben wie einen Tanz mit bloßen Füßen über Glassplitter empfindet. Vielmehr sucht er die Erde unter seinen Füßen, aus der die Pflanzen so unbesonnen sprießen. Vielmehr orientiert er sich an dem schwedischen Naturforscher Carl von Linné, der im 18. Jahrhundert mit Akribie die Pflanzen systematisiert und das botanische Denken revolutioniert hat. Der brachte Fantasie ins System und blieb doch streng dabei. In seinem Nachwort schreibt Hartinger über dessen „Nemesis divina“: „Eine Moral aus irdischer Ordnungsliebe, die Muster menschlicher Schicksale registrierend – dies zog mich tief ins Linnésche Buch von der ausgleichenden Gerechtigkeit“.
Die ausgleichende Gerechtigkeit? Zweifel zerschneiden das Denken in Mosaike aus bunten Glasscherben, wie sie die Kirchen des alten Byzanz ausschmückten. Mosaike aus Gedankensplittern. Unentwegt tasten der Blick des Autors und seine „halbautomatische écriture“ (aus Kamille) Pflanzen und Sprache nach ihren Möglichkeiten ab. Überraschung lauert hinter jedem Wort. Pflanzenbilder entstehen aus kompliziert aneinandergereihten Zufällen. Ingram Hartinger splittert die Sprache auf und streut die Scherben seiner Ideen zum schimmernden Mosaik einer „Wildnis von Träumen“ (aus „Das Magnolienbäumchen“). Herausgelöste Satzscherben verlieren sofort an Glanz. Kaum möglich scheint es daher, die Vielfalt in nur einem einzigen willkürlich gewählten Beispiel zu beweisen. Deshalb seien hier wenigstens zwei angeführt.
„Rosmarin. Steht hingewurzelt da mit goldbrauner Borke. Blätter gegenständig, braune Nüßchen. In zahlreichen Varietäten sein Habitus. Nichts für den Voyeur. Raschelt nicht mit seiner ledrigen Spreite. Arbeitet an keiner Idee. Wie hat das alles angefangen? Ein Fleck auf der Netzhaut? Im Augenwinkel, peripher? Frisch allerdings für den italienischen Koch. …“ (S. 37)
„Hibiscus. Im Gehege des Hibiscus verflocken sich multiple Ideen, die Zeit der Folter und des Wehgeschreis erscheint für einen kurzen Augenblick vorüber, ein anderer Sommer ergreift einen, man weiß nicht, wessen Schicksal mit welcher Spur sich vereinigt, o stumme Lippen, o ungeschiedne Seele, Hibiscus, sagt man, löse langsam den Bann, aber man weiß nicht einmal, welchen Bann, und so steht also am Verbannungsort Schreibtisch ein Hibiscus, der einen nicht vom schwindelnden Glück befreit …“ (S. 57)
Die Gemeinsamkeit der Bilder aus einer floralen Welt dient dem Autor dazu, sich nicht vollkommen in den Möglichkeiten des Denkens zu verlieren. „Tang und Distel“ ist ein Herbarium voll von Miniaturen, die sich an die Regeln des Bildhaften halten und daher nie den Rahmen einer Seite sprengen. Wir sehen und lesen sensible Gebilde, schwer von Ahnungen, schwebend leicht vor Sehnsucht, hell vor verhaltenem Witz, dunkel vor sanfter Erotik. Naturwissenschaftliche und philosophische Bemerkungen wechseln einander sprunghaft mit konkreten Begebnissen und tiefen Erinnerungen ab und werden zu Gleichnissen. „Welt schlüpft bisweilen in ihr pflanzliches Kleid zurück“ (aus dem Nachwort).
Nicht grenzenlos, doch zweifellos fühlt sich „der Betrachter“, der auch „der Sterbliche“ genannt wird, dem Pflanzlichen eng verbunden, findet sich bisweilen ident mit ihm. Vielleicht aus diesem persönlichen Empfinden gibt der Autor eher dem Baum, dem Gemüse und der bodenständigen Pflanze den Vorzug vor lieblichen Vertreterinnen des Gartenkatalogs. Die Verwandtschaft, sogar die Verschmelzung mit der Pflanze ist möglich und unabdingbar. An ihrem Beispiel findet der Versuch statt, das Große und Ganze, vor dem der Mensch mit seinen Fragen steht, zu erkennen. Linnés Ordnung kann dabei nur Anregung, doch keine Lösung sein. Und doch. Liegt da nicht der Vollzug der Linnéschen Moral in Hartingers eigenem Verschwinden und der Wiederkehr im Pflanzlichen?
Einmal eingetaucht in den Reichtum des byzantinischen Albums, mag man nicht mehr aufhören, zu blättern und sich immer neu überraschen zu lassen von der tiefsinnigen und zugleich unterhaltsamen Gedankenvielfalt. Der Glasscherbenteppich funkelt und schneidet sofort bei Unachtsamkeit. Wer wagt es, dem Autor über die Glassplitter zu folgen? Andererseits – wer wagt, gewinnt.