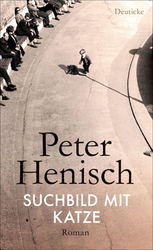„Seit ein paar Wochen schreibe ich an so etwas wie einer Autobiografie“, heißt es gegen Ende des Buches. Warum der Verlag sich bei einem so renommierten Autor bemüßigt gefühlt hat, eine Kindheits-Autobiografie als Roman zu betiteln, bleibt unklar. Oder sollten es doch „Verkaufsargumente“ gewesen sein? Wie dem auch sei, den Icherzähler mit dem Autor gleichzusetzen, wird dem Leser jedenfalls von Ersterem wie Letzterem nahe gelegt, nicht zuletzt, weil die biografischen Fakten von Romanfigur und Autor übereinstimmen.
Im ersten Kapitel trifft man Peter Henisch an einem Fenster eines Mietshauses im 18. Bezirk zwischen Währinger Straße und Kreuzgasse an, das den Anstoß gibt zu einer Spurensuche nach den Fenstern, „aus denen ich geschaut habe“. Das erste Fenster, an das sich der Icherzähler erinnert, befindet sich im dritten Wiener Gemeindebezirk in der Keinergasse, Ecke Hainburger Straße. Dort wohnte er mit seinen Eltern und einer Katze in einem zerbombten Haus, nein, in einer zerbombten Wohnung: Das zweite Zimmer gab es nicht mehr. Es war abgestürzt.
Der kleine Peter sitzt am Erkerfenster, er ist ein behütetes Kind, darf nicht alleine auf die Gasse, um herumzustromern, und als er es später doch noch erlaubt bekommt, wird aus dem nachdenklichen, altklugen Kind kein „Gassenbub“ mehr. Als ein „Kind, das gerne eine Katze sein wollte. Das heißt ein Kater“, beschreibt er sich selbst. Und Katzen sollen den Einzelgänger und Außenseiter durchs Leben begleiten.
Seine beste Kindheitsfreundin, die Tochter der Hausmeisterin, heißt Friedi, mit ihr spielt er die obligaten Doktorspiele, bis sie aus den Lehren ihres Kommunionunterrichts schließt, dass das Sünde sei. Peter wächst nicht religiös auf. Sein Vater ist Fotograf (Henisch widmete seinem Vater, dem renommierten Pressefotografen Walter Henisch, seinen ersten Roman „Die kleine Figur meines Vaters“), seine Mutter, eine schöne, junge Frau, Kind einer Arbeiterfamilie, hat als Dienstmädchen auf einem ungarischen Gut gearbeitet. Seine Eltern verstehen es zu leben und zelebrieren eine Art Weltläufigkeit zwischen Wien und der Wachau, für damalige Verhältnisse liberal.
Immer wieder wechselt der Icherzähler ins Heute, wo ihn eine „junge Frau mit Mikro“ über sein Leben interviewt und damit womöglich den Anstoß zu diesem Erinnerungsbuch gegeben hat, zu Reisen mit seiner Lebensgefährtin Eva, in die Welt von Laptops, Smartphones und T-Shirts mit Firmenaufdruck, die im Gegensatz steht zur zumindest medien- und konsumtechnisch kargen Nachkriegszeit. Manchmal meint man gar, einen Vorbehalt gegen die Jugend des beginnenden 21. Jahrhunderts durchzuhören. Ressentiment wäre jedenfalls ein zu starkes Wort für einen derart besonnenen Autor wie Henisch.
Seine Prosa unaufgeregt zu nennen, wäre fast schon wieder eine Übertreibung. Denn allein die Idee der Aufregung scheint dieser kontemplativen, genauen und einfachen, man möchte beinahe sagen nackten Sprache wesensfremd. Henisch geht denkbar sparsam um mit Adjektiven, Metaphern und Vergleichen und konzentriert sich auf die Wahrnehmung, auf den Tatsachenkern seiner Erinnerungen. Er gibt Innen- und Außenwelt gleich viel Raum und wirft einen poetischen Blick sowohl auf seine heutige Wirklichkeit als auch auf seine vergangene Lebenswelt, ohne Letztere dabei zu überhöhen.
Manchmal zitiert er Sätze aus seinen eigenen Werken, wie die Zeile „Ich bin erwacht in einem halben Haus“ aus dem Gedichtband „Hamlet Hiob Heine“ (1989). Er berichtet über die Entstehung seines ersten Gedichts (über ein Blümlein im Wind) und seiner ersten Geschichte (natürlich über eine Katze) und beschreibt, wie er, vermittelt durch die berufliche Tätigkeit seines Vaters, im Jahr 1951 die Hand des Wiener Bürgermeisters und Präsidentschaftskandidaten Theodor Körner schütteln durfte. Er evoziert die Not des Kindes angesichts der zwischenzeitigen Ehezwistigkeiten seiner Eltern. Die nationalsozialistische Vergangenheit des Landes, aber auch der Koreakrieg, die Atombombe und die Kubakrise stehen im Hintergrund.
In den Osterferien 1952 oder 1953 nimmt der Großvater den Neun- oder Zehnjährigen mit auf eine viertägige Wanderung am Semmering, wo sich am zweiten Tag die Zunge des schweigsamen Mannes löst und er vom gar nicht so lange vergangenen Krieg erzählt, vom gefallenen Onkel, davon, wie er die Oma kennen lernte.
Am Schluss lehnt der heutige Autor am Fenster und schreibt in ein ganz neues Heft. Neben ihm sitzt – wie sollte es anders sein – eine Katze. Ob er hier am zweiten Teil der Autobiografie arbeitet, bleibt zwar offen. Aber auf die Beschreibung seiner Jugend im Wien der 1950er und 1960er Jahre wäre man schon gespannt.