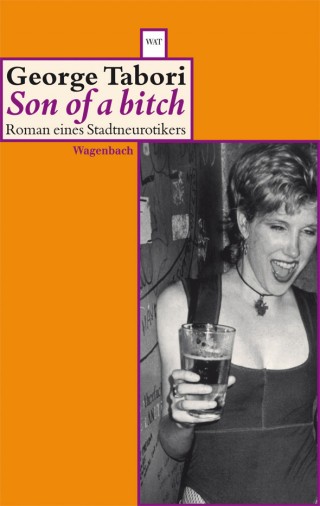Als Versicherungspolicenverkäufer im großen Stil ist Arthur Price als bester Salesman anerkannt, mit seiner Ehefrau verbindet ihn eine tiefe langjährige Haßbeziehung, seine Geliebte ist neurotisch wie in einem schlechten Film und mit den Showbiz-Größen und Sternchen ist er dank seines Sarkasmus und Zynismus auch auf Du und Du. Kurz: Arthur Price ist durch und durch ein Kotzbrocken.
Wahrscheinlich ist es der Bonus, den man einem Autor und Theatermann wie George Tabori angedeihen lässt, dass einen die hard-boiled Macho-Geschichte, die Sexismen wie besonders exotische Zierfische im Aquarium zur Schau stellt und kein Hollywood-Klischee auslässt, doch irgendwie interessiert. Man bemerkt Taboris Short-Story-Liebe, sein Amerikafaible, aber auch seinen schwarzen Humor, der trotz aller reichlich abgedroschenen Geschichten doch ziemlich genau menschliche Erbärmlichkeiten einzufangen weiß und im Grunde die Story eines Mannes erzählt, der – wie wir alle – nicht sterben will, obwohl es längst massive körperliche Anzeichen für den eigenen Verfall gibt. Einer, der sich für Unsterblich hält, wird eines Besseren belehrt. In Son of a bitch wirft Tabori einen mitunter gnadenlosen Blick auf die männliche Eitelkeit. Es gibt Gespräche über Krankheiten, wie das Haar schütter wird, Penis-Transplantate werden zum Thema, und der Psychiater darf in diesem neurotischen Großstadtjungel à la Woody Allen natürlich auch nicht fehlen. Und wie immer bei Tabori gibt es reichlich Witz und Witze: „‚Ein Mann müßte zwei Paar Genitalien haben‘, sagte Joe einmal auf dem Männerklo am Taconic Parkway. ‚Sein eigenes und ein gutes.'“
„Es wird euch allen leid tun, wenn ich tot bin, aber kann ich euch nicht leid tun, solange ich lebe?“, stöhnt der körperlich angeschlagene Price wehleidig, aber nicht, ohne zumindest im Ansatz mitzubekommen, daß einem letztendlich nur das zurückbezahlt wird, was man ausgeteilt hat. Die Diagnose ist Krebs, der letzte Teil der Erzählung behandelt ausführlich die Stunden vor der Operation. Price denkt vor allem an seinen Sohn, und angenehmerweise gelingt es Tabori, die Kurve rechtzeitig zu kratzen, bevor es in Richtung Gefühlskitsch geht. Ein Zyniker bleibt Price auch, wenn er eingestehen muß: „Wir lachen ein bißchen. O Gott, Humor war doch früher okay, jetzt ist es nur eine Flucht vor dem Schreien.“ Aber es wäre nicht Price, würde er seinen vermeintlich letzten Weg ohne Publikum gehen: „Ich nehme einen Oscar für den besten Tumor des Jahres in Empfang“.