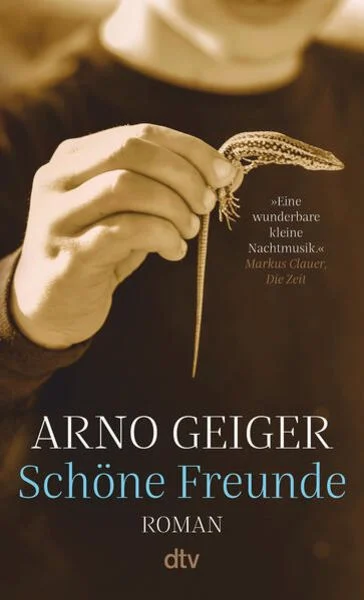Schöne Freunde ist jedoch kein Roman einer dörflichen Jugend, wie wir viele Beispiele zu kennen glauben. Wie bei Lipus handelt es sich vielmehr um eine Beseitigung des Dorfes, bei Geiger allerdings von keinem oppositionellen Impetus beseelt, seine Figuren arbeiten sich nicht an den Verhältnissen ab, sie scheinen vielmehr ruhe- und ratlos in ihnen zu schweben. Nicht vom Menschen, von der Natur geht die Beseitigung aus – ein schweres Grubenunglück löscht mit einem Mal einen Teil der Bevölkerung aus und führt zu einem Exodus der Überlebenden. Der Leser erfährt nicht, ob damit das Dorf verwaist, Geiger beschränkt sich konsequent auf die Welt Carlo Kovacs‘, seines Erzählers. Diese Welt ist wunderlich und vage – wunderlich durch das magische Denken, mit dem Carlo die ihn umgebende Natur und Topographie überzieht, und vage durch die Veränderungen, die sich in ihm und damit auch in seiner Wahrnehmung vollziehen und die ihm, wie allen Aufwachsenden, ein Verständnis der Welt erschweren. Dem Leser wird allerdings wenig Möglichkeit zur Empathie gegönnt, durch zahlreiche Verfremdungen verhindert Geiger Assoziationen mit der eigenen Adoleszenz: Das Dorf bleibt namen- und konturenlos, das Kind wächst vereinzelt, ohne Eltern und gleichaltrige Freunde auf, die „typischen“ Ingredienzien einer Kindheit fehlen. Geiger entführt uns vielmehr in eine bilderreiche, melancholische, in Grau getauchte Zwischenwelt voll skurrilem Personal, die Erwachsenen sind eingezwängt in bürokratische Rituale, lauter Abgetakelte, in ihrer Sexualität und Liebe nicht weniger skurril und undurchschaubar. Carlo versucht sich Verhaltensweisen „für später“ anzueignen, abzuschauen (etwa das „Schnalzen mit der Unterhose einer Frau“). Im Zentrum steht die Figur des Direktors des Bergwerks, eine Art Ersatzvater für den Ich-Erzähler, dem nicht Carlo, sondern sein „Wunderbitter“ das Wichtigste ist – ein Getränk, dessen Zutaten schwer aufzutreiben sind – und dem Carlo dennoch überall zur Hand geht. Wenn die kleine Gesellschaft im zweiten Kapitel („Auf dem Schiff“) alles hinter sich lässt, um sich schließlich nach einer ersten Überfahrt im Irgendwo der Kaschemmen einer Hafenstadt zu verlieren, fühlt man sich mitunter an die Metaphernwelten Ransmayrs erinnert oder assoziiert Filmbilder Fellinis, beide arbeiten ja parabelhaft im Überzeitlichem, Un-Örtlichem, der „Akkordeonspieler“, ein unscheinbarer, schweigender, aber ständiger und unverzichtbarer Begleiter und musikalischer Kommentator des Geschehens, scheint direkt Fellinis „8 1/2“ entstiegen zu sein.
Das sind natürlich nur hilflose Versuche, in Geigers Prosa Halt zu finden, der Waschzettel des Verlags hat mit der abgegriffenen Phrase des „ganz eigenen, unvergleichlichen Tons in der Gegenwartsliteratur“ durchaus Recht. Der Vergleich mit Fellini rechtfertigt sich zudem vielleicht noch mit der Schnitttechnik Geigers, mit der er zwischen den Erinnerungsbildern und den Vorkommnissen während der Flucht/Reise hin und her schaltet. Der Hinweis auf Ransmayr hinkt vor allem durch die völlig unterschiedliche Sprache, Arno Geigers klarer Prosa fehlt das Überschwängliche, mythisch Aufgeladene, wenn ihr auch stellenweise das Pathetische nicht unbekannt ist. Das kann dazu führen, dass einem das eine oder andere Bild nicht zusagt (er „saß … inmitten der löchrigen Phantasien dieser Nacht“) oder die Schlusssequenz subjektiv zu parabolisch und pathetisch erscheint.
Geiger lässt an keiner Stelle des Romans Zweifel aufkommen, dass hier das strenge Kalkül eines großen Organisators obwaltet und dass der Ich-Erzähler nun kein Kind mehr ist. Man erfährt zwar nichts über die gegenwärtige Verfasstheit (oder etwa das Alter) des Erzählers, aber die (notwendige) Distanz zu den vergangenen Geschehnissen wird mit „gegenwärtigen“ Kommentaren klargestellt. Wobei der Erzähler nicht im herkömmlichen Sinne „kommentiert“, Geiger gelingt es mit einfachsten Mitteln die Künstlichkeit seiner – und damit jeglicher – Rückblicke zu vermitteln: durch gezielte, spärliche Wechsel ins Präsens („Ich beschreibe den Tennisplatz“) und durch permanentes Hinterfragen der beiden Schüsselwörter „einmal“ und „irgendwann“ („Was ist einmal?“). Mit diesen Kunstgriffen und ihrer Repetition nähert Arno Geiger – und das scheint mir die wahre Kunst dieses Romans – sein Erzählen dem Rituellen an, und Erinnern ist immer auch Ritus.
Ein wichtiger Bestandteil dieses Ritus ist die Liste der beim Grubenunglück Getöteten und seither Vermissten, die der Direktor mit sich führt (über diese Bedeutung wissen wir etwa von Josef Winkler). Das wiederholte Aufsagen der Namen in der namenlosen Topographie wird zu einer liturgischen Vergewisserung des Verlusts – „Schöne Freunde“ ist in erster Linie ein Lied auf den Verlust. Neben den Namen der agierenden Figuren, die alle in kindlicher, respektvoll-utilitaristischer Nennung aufscheinen („Frau Doktor Bianchi“, „Die Frau des Sprengmeisters Binder“), wird die am Schluss des Romans vollständig angeführte „Liste der Toten und Vermissten“ so zu einem Anhalts- und Angelpunkt. Und für Carlo zu einem Manifest des Verlusts der Kindheit.
Trostlos muss der Ich-Erzähler jene Welt nicht hinter sich lassen, er weiß immerhin um die Existenz der Liebe. Und der Leser hat ohnehin keinen Grund, trostlos zu sein, dieses genau komponierte und geschickt in Schwebe gehaltene Buch ist befremdend, bizarr und eines stets vorweg: ein Faszinosum.