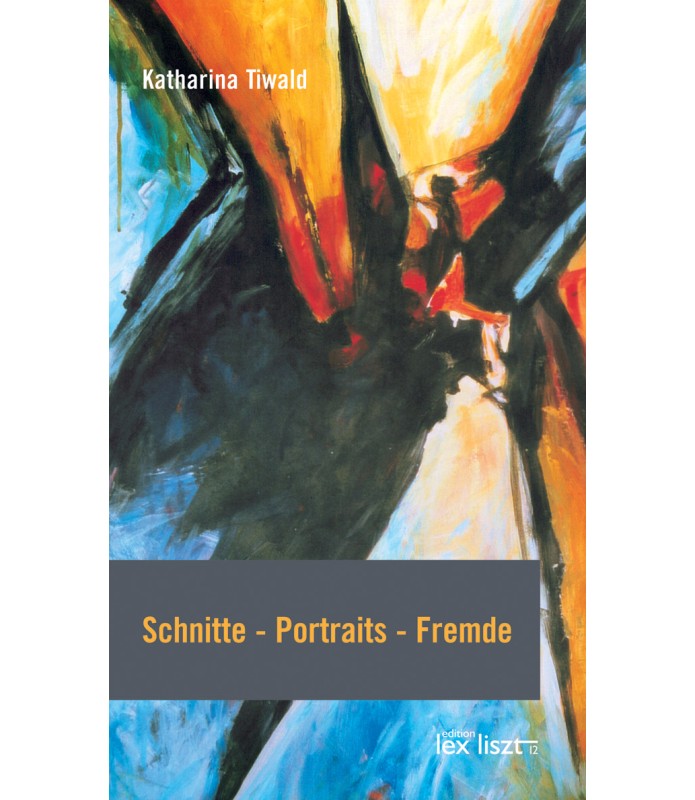Tiwalds Sprache zeichnet ihre Bewegungen nach, ihre Gedankengänge und Fußwege, hakt sich ein, wartet, „dass sich Dinge zutragen werden“. Ihre Erzählungen nehmen ihren Anfang bei der sinnlichen Wahrnehmung, am Anfang stehen Launen, Geräusche, Gerüche, Bilder, Körpererfahrungen, Lust und Schmerz – das Schreiben ist ihr „eine sekundär modellierende Kunst.“ Sie beobachtet Gesichter, Gesten, Bewegungen, sie lauscht den Geräuschen der Straßenbahnen Wiens, dem Stimmengewirr in den Straßen St. Petersburgs, der Musik Johannes Maria Stauds und fängt ihre Impressionen wie Nabokov seine Schmetterlinge mit dem feinmaschigen Netz der Sprache: „Dieses Mal hat mich nicht eine Holzfaser angestoßen, kein Gesicht in der U-Bahn, kein einzelnes Wort; diesmal war es ein großes Klangnetz, in das ich geradewegs gelaufen bin, mit einem lächelnden Spinnenmeister. Was noch entsteht, weiß ich nicht. Ich werde meinen Schreibtisch befragen.“
Tiwalds Sprachverfahren – nicht jedoch ihre Themenwahl und ihr Tonfall – erinnert dabei an Elfriede Jelinek, die ihr eigenes Schreiben als musikalisch, als kompositorisch bezeichnete, ausgehend von der Materialität der Worte. Wie die Nobelpreisträgerin reflektiert Tiwald ihr eigenes Sprachverfahren stets mit, sie stellt ihre Sprache aus, sie versucht nicht, Brüche zu kaschieren, Kanten abzuschleifen, Oberflächen zu glätten, ihre literarische Sprache stellt sich selbst in ihrer Gemachtheit aus. So verfängt sich Tiwald und mit ihr der Leser in den „kleinen Fußfesselchen aus Worten“, wie es im Klappentext in Anlehnung an den russischen Literaturtheoretiker Viktor Schklowski heißt, gemäß der Aufgabe des Autors, „dem Leser ein Bein zu stellen, aus Zuneigung zu den Dingen der Welt, allem Erlebbaren, und aus einer großen Sprachverliebtheit.“
Tiwalds Schreiben eignet ein für die österreichische Literatur typisches Moment der Sprachskepsis, doch anders als etwa Hofmannsthal in seinem Chandos-Brief verzweifelt sie nicht an der Unzulänglichkeit der Worte, sondern kostet lustvoll die Möglichkeiten und Grenzen des Sprachspiels aus. Sie entlarvt mit dem geschulten Auge einer Sprachwissenschaftlerin – sie hat in Wien, Glasgow und St. Petersburg Linguistik und Russisch studiert – die scheinbare Natürlichkeit und Glätte der Sprache als Täuschung, als falsches Versprechen, sie ringt mit ihr, dreht und wendet die Wörter, tastet sie vorsichtig ab, befragt sie nach ihrem Klang, ihrer Bedeutung, ihrer Struktur, besonders dann, wenn sie den Blick auf andere Sprachen richtet, etwa auf das Russische oder Schweizerdeutsche: „Die Laute kommen aus tieferen Gründen der Kehle. Die Wortbetonung schlüpft nach vorne, und verdattert fragt sich das gsi, wo denn das wesen im Gewesen verblieben ist.“
Der Tonfall der Erzählungen ist meist heiter, manchmal auch ernst, doch stets von einer schwerelosen Leichtigkeit, augenzwinkernd, selbstironisch, oft „im Modus des Kabaretts, damit man trotzdem alles auch ins Lachen verschieben kann“, doch niemals seicht. Sie erzählt von der „unerträglichen Leichtigkeit des Seins“, Anekdoten von Straßenbahnfahrten Katharinas der Großen und nächtlichen Spaziergängen durch die bittere Winterkälte St. Petersburgs, sie erzählt in inneren Monologen von ihrem Versuch, „einen richtig Fremden zum Ficken zu finden“ und von Katja, die ihrem „Blickwinkel nach Basel“ nachgefahren ist und nun barfuß, strickend, durch den Wiener Schnee läuft, sie erzählt von Bernd, der nach Basel marschiert, um auf einem Gynäkologenkongress gegen Abtreibung zu protestieren und von „Julia, schwanger, in Sankt Petersburg.“ Sie erzählt von Frauen und Männern, von Intimität und Entfremdung, vom Tschetschenienkonflikt und von Brustkrebs, von Schwangerschaft und Tod, „von einem Treffen mit einem Komponisten, der Fassung von Musik in Worten und der Entstehung eines Wortkonzerts.“
So vielseitig Tiwald ihre Themen wählt, so virtuos spielt sie mit verschiedenen Registern der Sprache, mit Idio- und Soziolekten, mit Rhythmus und Form, schreibt Prosaminiaturen, innere Monologe, Skizzen, Portraits, „Werktagswortschwälle“ und „Wortkonzerte“. „Syntax, Komma, Fehler, die Schönheit der Worte“, das ist ihr Metier, wie Tiwald selbst an einer Stelle von sich behauptet. Sie spürt den Rhythmen der Worte, der Melodie des Satzes nach, aufmerksam auf feine Nuancen, sie baut sich ein Gerüst aus Silben, ein Haus der Sprache, in das sie ihre Erzählungen hängt wie Mäntel in einen Kleiderständer. So handeln ihre, wie sie vermuten lassen, weitgehend autobiografischen Erzählungen im Grunde stets (auch) vom Erzählen selbst, von der Möglichkeit des Schreibens „als Gabe der Schmiegsamkeit, der Anschmiegsamkeit an die Wirklichkeit“, wie es Jelinek in ihrer Nobelpreisrede formulierte.
„Wien, flüchtig zu skizzieren. Im Winter – und wir schreiben winter – “
Jede einzelne der Erzählungen enthält Stoff genug für einen Roman, doch Tiwald ist eine Meisterin der Kurzform. Sie erzählt mit einem Blick für die kleinen Details, für die zarten Gesten, für die leisen Untertöne. Und der Leser folgt diesem Blick und schaut mit ihr „auf eine Geschichte mit schmalen Augen, denen die Atemzüge auffallen, die kleinen Gesten und Winke, die Stimmungen und wie das Wachsen dieses Schauens in ein fedriges Netz aus Worten,“ ein fedriges Netz, in das sich der Leser dieses wunderbaren Erzählbandes nur zu gerne einspinnen lässt.