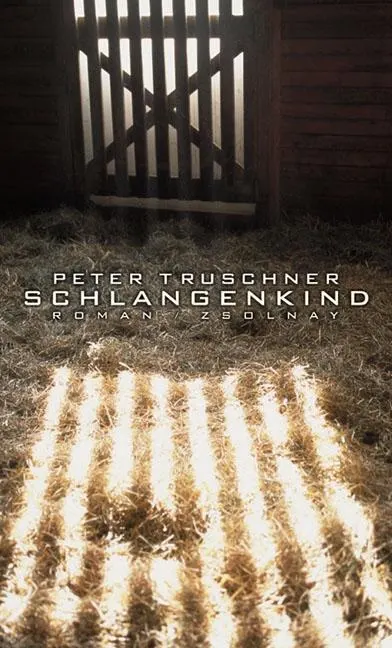Schon der Klappentext zitiert keinen Geringeren als Peter Turrini, der in derselben Kärntner Ortschaft groß wurde, die neben Salzburg der Hauptschauplatz des vorliegenden Romans ist. Truschners autobiographisches Ich wächst in den siebziger Jahren auf dem Bauernhof seiner Großeltern auf, nachdem die Mutter – nach der Scheidung von ihrem Ehemann-Zuhälter und Vater ihres Kindes – ihr Glück in der Stadt (Salzburg) suchte. Seine Kindheit ist geprägt von einem Großvater, der durch den Krieg ging und dessen raue Sitten auf seine Ehe und Familie übertragen hat. Eines der ironischen Details dieses Romans: Nur beim „Mensch ärgere dich nicht“-Spiel gesteht er der Großmutter einen Sieg zu, in der Gewissheit, dass sie ansonsten in allen Lagen haushoch unterlegen ist. Nichtsdestotrotz scheint der Enkelsohn den lethargisch-jähzornigen Großvater zu mögen, während die Tochter ihm gegenüber aufgrund ihrer um vieles drastischeren Kindheitserlebnisse ihrem Vater gegenüber nur Hassgefühle aufbringt.
Die Großmutter ist das eigentliche Opfer der Geschehnisse. Ständig den Grobheiten und der Ignoranz ihres Peinigers ausgesetzt, bürgte der Enkelsohn zumindest für eine emotional positiv besetzte Nische in ihrem Leben. Als die Tochter nach 12 Jahren ihr Mutterrecht einfordert, bleibt die Großmutter allein in den Ruinen ihres Daseins zurück und stirbt nach jahrelangem qualvollem Siechtum. Der Abschnitt, wo Truschner mit Härte seine eigenen Versäumnisse rund um das Ableben seiner Großmutter beschreibt, gehört zu den besten Passagen dieses Romans.
In jeder Hinsicht bleibt das Heranwachsen im Kärntner Dorf sowie die Jugend in Salzburg frei von Romantizismen oder Sentimentalität. Die prägenden Personen und Erlebnisse sind jeweils einem eigenen Kapitel zugeordnet. So erschreckend realistisch die einzelnen Bilder unterm Strich erscheinen mögen, die poetische Sprache Peter Truschners vermag der Brutalität der Geschehnisse eine magisch-mystische Note abzugewinnen – „Dann kam das Dorf – und Kinderphantasien waren zumeist nicht mehr Aufhebens wert als die Schlangen, die von den Autos auf den Straßen plattgewalzt wurden.“ (S. 78).
Metaphernreich verwebt der Autor die Natur mit den Menschen und trifft unfehlbar ins Zentrum der Konfliktstoffe in einer Welt voll aufgestauter und unterdrückter Gefühle. Die Charakterisierung der Figuren gleicht streckenweise dem Akt des Schmetterlingsfangens. Der Autor umkreist sie mit Worten, um dann mit einer gezielten Bewegung seine Beute einzufangen. Aufs feinste spiegelt er die Doppelbödigkeit der Wirklichkeit in der Doppelbödigkeit eines jeden Wortes.
Das (halberotische) Mutter-Sohn-Verhältnis, das in der gemeinsamen Salzburger Stadtwohnung Höhen und Tiefen sowie verschiedene mütterliche Liebhaber übersteht, wird vom Autor auf die schlichte Formel verkürzt, dass die Mutter des Sohnes einziges Interesse sein und bleiben wollte.
Die Emanzipation des Icherzählers ist geprägt von einem jahrelangen Konflikt zwischen Anziehung und Abstoßung. Der Blick auf die Mutter – erschreckend nüchtern – sowie die eigene Sexualität stehen am Ende des poetischen Reigens, der in wenigen Szenenbildern eine komplexe Jugend bündelt.
„Als sich mein Sperma in Tita verteilte wie schäumendes Licht, glaubte ich zu spüren, wie der dunkle Blick meiner Mutter seinen Weg mitvollzog – ein Blick, der Menschenfleisch durchbohren konnte wie ein Zahnstocher ein Stück Käse oder eine Olive und dem diesmal nichts anderes blieb, als sich zurückzuziehen, sodass ich mich nicht umzudrehen und aus Titas Kuss zu lösen brauchte. Ich fühlte mich wie ein Neugeborenes, rot im Gesicht und nach Leben japsend. Mit meinem Schweiß war auch der Lebenskampf meiner Mutter endgültig von mir abgetropft, jene unfruchtbare Blase, die bei meiner Geburt offenbar übersehen und nicht entfernt worden war.“ (S. 175)