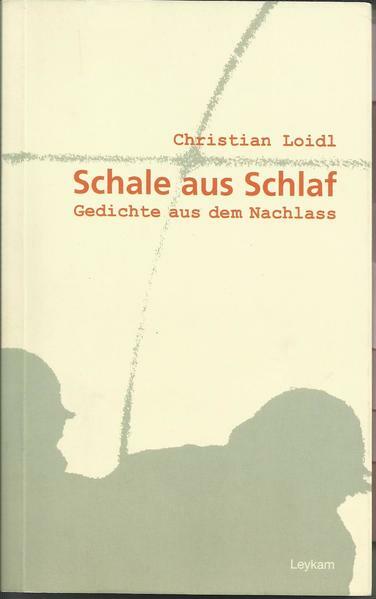Dichter und Dichterin sprechen nach ihren eigenen Regeln. Loidl ist einer, bei dem dieses Bedürfnis stark ausgeprägt ist und bewusst transportiert wird. Das mag zunächst verwundern, denn weder sind seine Texte experimentell noch spekuliert er auf „absolute“ Form oder bedient er sich komplizierter Kompositionsprinzipien auf programmatische oder inflationäre, auffallende Weise. Seine lyrischen Zeilen wirken auf den ersten Blick zart und flüchtig, wie so dahin geschrieben, skizzenhaft. Tatsächlich sind sie radikal. „Realistische“ und surrealistische Wahrnehmungsebene sind zusammengewirkt, ohne dass das Resultat ein sich selbst beißendes hybrides Gestrick wäre. Es scheint – vermutlich ohne es auch nur zu implizieren, geschweige denn zu explizieren – als würden diese Gedichte uns weisen: Jede Sprachkonstruktion, jedes „absolute“ Regelwerk, sei es natürliche Sprache, sei es ins Absolute getrimmter Manierismus, vermag nicht mehr zu leisten – die Vermittlung ästhetischer Erfahrung nämlich – als diese leichtfüßigen, einfachen, lyrischen Gebilde hier. Wobei Loidls einfache Intention ist zu beschreiben, der Wahrnehmung nachzugeben, und zwar recht unverfälscht. (Selbstverständlich wird auch dieser Zustand konstruiert sein.) Als würde der Dichter sagen wollen: Der ästhetische Erfahrungsprozess bedarf nicht notwendig einer „Verkunstung“ und der Anstrengung. Und damit hat er sehr Recht.
Die Wahrnehmungsebenen sind ineinander geschoben. In „einer kennt alles beim namen. // der himmel und die sterne sind / ein tierfell, und auf dem fell / liegst du, geboren / zur sprache.“ beispielsweise ist „tierfell“ zwar auch Metapher, doch primär realistisch zu verstehen. Ein Name ist zunächst das Gegenteil einer Metapher, eine harte Denotation. Wenn einer den Himmel als Tierfell sieht oder träumt und ihn in seiner lyrischen Sprache so nennt, dann ist die Bezeichnung „Metapher“ schlichtweg unzureichend, falsch, gewaltsam, viel zu sehr Trug, viel zu sehr das dichterische Wort als Hilfsmittel suggerierend. Der Dichter ist zwar Unterscheidender zwischen Traum und Wirklichkeit. Aber die Aussage, was von Traum und Wirklichkeit mehr oder weniger „Haut“, „Haus“ und „Hauch“ des anderen ist, treffen sie beide selbst: DichterIn und LeserIn – nimmt man lyrische Wahrnehmungs- und Schreibweisen so ernst wie die natürliche Sprache. (Solche Offenheit setzt freilich ein konstruktivistisches Verständnis der „Wirklichkeit“ voraus.)
Die Unbestimmtheit der Referenz auf das Ordnungsnetz verantwortet zuweilen einen Eindruck des Kryptischen, Traumwandlerischen: „angst: ein puls unter / der außenhaut über-/ nimmt wein weil / der traum weiter / reicht als ich dachte“. Und Loidl treibt dieses Spiel fast ins Explizite. Fast heißt: Nur so weit, dass der Leser sich sicher sein kann, er spielt es bewusst, und als bewusste Konstruktion wirkt sie absurd und zuweilen ironisch: „gib mir gewichte / ich weiß nicht / ob es gewichte gibt“.
Loidls Gedichte weisen teilweise große Ellipsen auf – oder die Sätze sind sehr lakonisch. Beide Beschreibungsgesten werden den flüchtigen Inhalten gerecht: Loidl setzt seinen Wahrnehmungsapparat der Digression aus. Die Sprachbilder präsentieren niemals geschlossene Szenarien. Gerade für seine Arbeit auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen, für den Sprung nämlich von einer Ebene auf die andere (Realismus, Surrealismus) bietet sich Lakonie an. Oft verweilt „das lyrische Ich“ (ich meine den rezipierenden Leser wie Schreiber, versteht man Schreiben als produktiven Lektüreprozess) einen Moment auf einer Ebene, springt, mischt die Ebenen dann, schüttelt die Mischung aber nicht sehr: „sonne, gesiebt / durch laub / flicht mir / ein haarnetz / aus licht. // jemand / bückt sich, / hebt / einen apfel / auf. / am steilhang bar- / füßige frau. // mit / den wolken / treibt / ein blaues / kind und / streckt / die hand / aus“. Solche versweisen Abwechslungen von Realismus und Surrealismus passen unter dem (um es provokant zu sagen: realistischen) Mantel des erkenntnistheoretischen Konstruktivismus gut zusammen und sind keineswegs beliebig.
Elliptische Form und Ebenenwechsel begegnen dem Leser und der Leserin auch bei Loidls Haikus „nachtanhaltspunkte“. Er wolle das Wort vom „Wiederholungsfluch“ befreien, meint er in „Schale aus Schlaf“. Von daher die fluktuierenden Bilder. Dieses Unterfangen wird in den Haikus sehr deutlich, sind sie doch, wie Leopold Federmair in seinem Vorwort expliziert, Dreischritte vom Erwachen zum Höhepunkt in den Tod oder vom Aufblühen zum Glänzen in die Kehre.
Einige Loidlsche Haikus befreien auf erfrischende Weise von jenem Fluch, indem sie die zweite Ebene/Zeile (Höhepunkt, Glänzen) in die unerwartete Tiefe, ins nur Erklärende oder gar Banale lenken. Dabei sabotiert der Dichter auch diese „Regeln“ des Haiku: „reißverschlossen. das gesicht / leergeschminkt. hockend / die reisetasche“. Oder: „das schöne gesicht / das sich so wenig bewegt / gehört niemandem“. Oder, Banalität provozierend: „wieder schreit der frosch / hinter den schwarzen bäumen / unterm abendstern“. Ein schöner Haiku ist: „chrysanthemen: / gelbe pinsel / die sich selber malen“. Das „lyrische Ich“ springt von der ersten, realistischen Beschreibungsebene und Zeile auf die zweite, surreale Höhe, um dort zu bleiben, die dritte Ebene erklärt die zweite nur noch; ein klassischer Haiku. Doch zugleich auch andeutend, wie Loidl die zweite als Bindeglied zu nutzen weiß: Was Höhe, was Tiefe für den Leser sind, scheint er nicht mit der Zeilenvorgabe vordefinieren zu wollen – für die Freiheit des Rezipienten. In der Tautologie kann die zweite Zeile beides zugleich sein: Höhe und Tiefe: „na und?“ / der raum / und das alles“. (Was ist nicht Raum?)