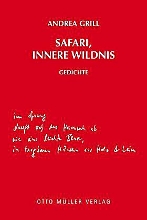Grill ist (auch) Biologin, der naturwissenschaftliche Ansatz scheint in ihren Gedichten bisweilen zart durch, wenn etwa von DNA oder Begriffen wie Taxonomie die Rede ist. Das passt gut zur Lyrik, vielleicht nicht einmal besonders überraschend, wohnte doch bereits dem Thema ihrer Doktorarbeit über die Evolution endemischer Schmetterlinge Sardiniens eine gewisse Poesie inne. Die literarische Bearbeitung ihrer Sujets wird denn auch nicht in eine vielleicht zu befürchtende nüchterne oder gar ernüchternde Mitleidenschaft gezogen, vielmehr gelingt es ihr, den sezierenden Blick auf die Dinge für ihre Kunst zu nutzen. Sie verharrt nicht im Beobachten, was ja allein noch kein Gedicht ausmachen würde, sondern versteht es, die Details auf sehr souveräne Art und Weise miteinander zu verbinden und zu erschließen: „[…] wie die Lachmöwe von der Küste/nach innen fliegt,/ bis sie einen McDonalds findet,/Pommes Frites aus dem Abfall pickt,/praktisch gesinnt, wie wir nicht sind;/ihr schwarzes Gesicht dir zeigt/ihre Regenpfeiferseele“ (S.29).
Wenn die Gedichte von Andrea Grill auch zur Gänze aus freien Rhythmen zusammengesetzt sind, so ist ihre äußere Formensprache doch vielfältig. So beginnt das Buch mit einem kleinen Zyklus namens So ist das, und das erste Gedicht besteht aus vier Terzetten, das zweite aus Quartetten, das dritte aus Quintetten und so fort, bis sie nach dem ersten Oktett des sechsten Gedichtes die Form durchbricht und ein Septett und einen Zweizeiler folgen lässt, um dann im nächsten Gedicht wiederum beim Terzett anzusetzen. Sie nutzt konsequent die Gestaltungsmöglichkeiten strophischen Baus, bis der Leser meint, eine nachvollziehbare Ordnung gefunden zu haben, und lässt das ganze Gebäude dann in genau diesem Augenblick wieder einstürzen. Es ist eine schöne Analogie zur Erfahrungswelt der Grill’schen Verse, aus denen die Essenz zu sprechen scheint: So ist das Leben, und nun finde die Stelle, an der du falsch abgebogen bist.
„ich nehme den Tag/unter die Achsel/trage ihn nach Hause//setze ihn/vor mich hin/ auf die Couch/und wir plaudern eine Weile“ (S.48). Selten geht es in den Zeilen von Andrea Grill einfach nur so surreal zu. Die Brechung in den Texten ist freilich immer vorhanden, jedoch oft feiner und voll von sinnlichem Erleben. Es verwundert kaum, wenn sich daher viele der Texte auch als Beziehungs-, gar als Liebesgedichte lesen lassen, auch wenn das nicht oder zumindest nicht immer unbedingt intendiert gewesen sein muss: „deine Handgriffe nachahmend/Rezepte für Extasen;/Delikatessen aus Wildfang:/leere Hände voller Finger“ (S.62).
Die Bildsprache von Andrea Grill entspringt ebenso der hörenden, schmeckenden, fühlenden, sehenden und riechenden Wahrnehmung, häufig gekoppelt mit Termini aus Flora und Fauna: so ist von „herbarisierten Stunden“ (S.41) und „gefingerte[n] Blattspitzen“ (S.63) die Rede. Mitunter werden auch die Namen von allgemein weniger bekannten, jedoch real existierenden Wesen wie z.B. „Federgeistchen“ (einer Schmetterlingsfamilie) aufgerufen, die als charakterisierendes Moment für menschliche Eigenschaften stehen: „hab dich noch nie mit Gepäck gesehen“ (S.62). Echte Neologismen finden sich weniger häufig, doch wenn, dann sind sie ausnahmslos von großer Ausdruckskraft und Originalität, etwa wenn Grill von Vögeln als „Strauchhäusigen“ (S.19) schreibt, von Kreaturen, die wie „zappelnde stille Urknallchen“ (S.39) sind oder von einem Geschöpf namens „Herzkitz“, mit welchem das lyrische Ich in Verbindung gebracht wird („Blut verlangt bruchfeste Gefäße/pass ich noch in einen Körper?/mich kitzelt mein Herz“, S.33).
Ein immer wieder auftauchendes Moment in der Lyrik von Andrea Grill sind die Einsprengsel auf englisch, französisch und vor allem italienisch: eine Reminiszenz an die zahlreichen Auslandsaufenthalte der Autorin? Das wirkt sich mitunter eher irritierend auf den poetischen Fluss aus und ist auch in anderer Hinsicht nicht ganz unproblematisch: Man könnte argumentieren, dass hier schlicht jemand seine Weltläufigkeit literarisch in Szene zu setzen versucht. Doch wer sich lange in einer fremden Sprache aufhält, beginnt in ihr zu denken, sogar zu träumen. Vielleicht sind diese fremdsprachlichen Inseln weniger kalkuliert, als dies auf den ersten Blick erscheinen mag; vielleicht sind sie nur Ausdruck von Erinnerungen an eine Situation oder an Erfahrungen, die die Autorin einst irgendwo auf der Welt machte, die im Moment des Schreibens urplötzlich in ihrer Originalsprache bis ins Hier und Jetzt hineinragen und deshalb auch als Zeugen des unmittelbar Erlebten dem möglichen Einspruch eines Lektors gegenüber verteidigt werden müssen. Dann hat ein solches Verfahren im Hinblick auf die Authentizität des Geschriebenen sicherlich seine kompositorische Berechtigung – und bei Kenntnis der Grill’schen Vita kann man das durchaus nachvollziehen.
Denn diese schiere Unmittelbarkeit des Erlebens ist es ja gerade, die den/die LeserIn von Zeile zu Zeile trägt. Durch die Augen der Dichterin werden die eigenen Erfahrungen in ihrer Parallelität nur noch plastischer und erinnerbarer. Das ist es, was eine Lyrik des Augenblicks im besten Falle (und eben auch im Fall der vorliegenden Gedichte von Andrea Grill) vermag: mitzureißen in das Abenteuer der beständigen Gegenwart, gleichwohl ohne die innere Balance zu Vergangenheit und Zukunft zu verlieren – zum Woher und Wohin der eigenen Existenz.