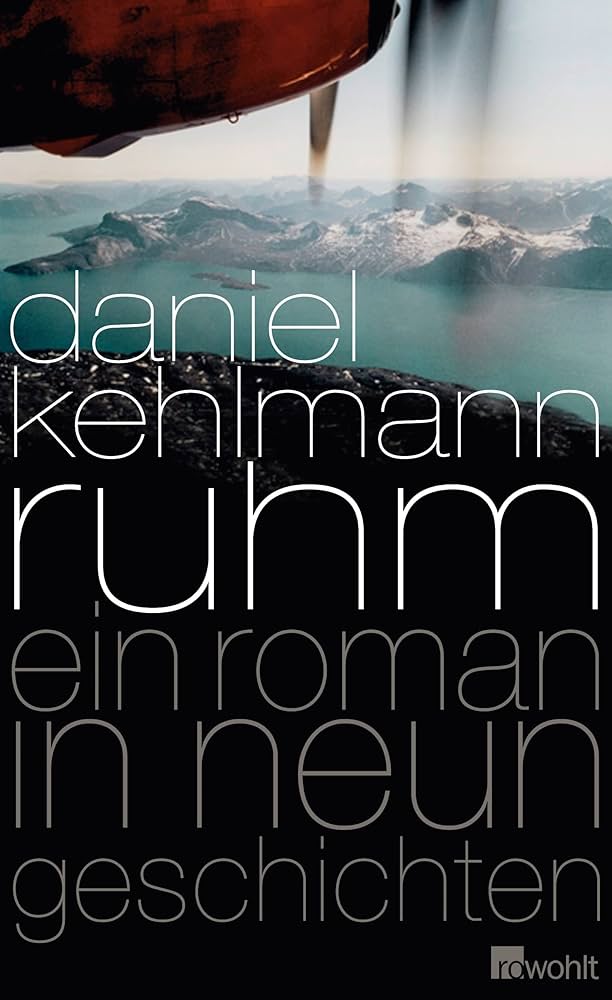Einen „Roman in neun Geschichten“ kündigt der Untertitel an, geschickt sind die einzelnen Erzählungen aufeinander bezogen. Das Geflecht der einzelnen Handlungsbögen und Figurenkonstellationen erschließt sich dem Leser erst nach und nach und steigert so die Lust am Text. Einem komplexen Bauplan folgend entführt Kehlmann seine Figuren und Leser in ein labyrinthisches Spiegelkabinett und treibt mit ihnen ein postmodernes Spiel mise en abyme – „Geschichten in Geschichten in Geschichten.“ Der Einsatz ist hoch: verhandelt werden Fragen nach Identität, nach Realität und Fiktion, nach der Bedeutung des Verhältnisses von Wirklichkeit und Literatur, nach dem Kunstwerk im Zeitalter von Internet und Mobiltelefon.
Dabei klingt die Medien- und Technikkritik, die sich als roter Faden durch das Buch zieht, im Jahr 2009 seltsam naiv und eindimensional: „Wie log und betrog man, wie hatte man Affären, wie stahl man sich fort und manipulierte und richtete seine Heimlichkeiten ein ohne die Hilfe hochverfeinerter Technologie?“, fragt sich etwa der Abteilungsleiter einer Telekommunikationsfirma verwundert. Doch wie weit reichten andererseits die Möglichkeiten der Identifizierung, Ortung und Überwachung ohne eben diese technischen Hilfsmittel? Diese unheimliche Kehrseite der Technologien scheinen die Figuren und ihr Autor zu übersehen. Zu verlockend sind die Möglichkeiten von Anonymität, Identitätswechsel und Doppelleben, die Handy und Internet eröffnen.
So erreichen den biederen Techniker Ebling plötzlich Anrufe von fremden Frauen und falschen Freunden, die eigentlich dem Filmstar Ralf Tanner gelten. Bei der Nummernvergabe muss etwas schief gelaufen sein. Für kurze Zeit kann Ebling daher sich und seinem Alltag entfliehen und sich der Illusion hingeben, dass „Ralfs Dasein ja immer schon für ihn bestimmt gewesen“ sein könnte, und „nur ein Zufall ihrer beider Schicksale vertauscht“ habe. Welche Auswirkungen die Umleitung der Anrufe auf Ralfs Schicksal hat, erfährt der Leser an späterer Stelle, in einer anderen Geschichte.
Dem Zufall ist es außerdem zu verdanken, dass an Stelle von Leo Richter – Kehlmanns alter ego – eine Autorin von Kriminalromanen eine Lesereise nach Zentralasien antritt und dort aufgrund einer Verkettung unglücklicher Umstände verloren geht: sie verliert den Anschluss an ihre Reisegruppe, ihr Handy versagt, das Visum ist abgelaufen, es führt kein Weg zurück. Außer der Erzähler will es so…
Der Autor geriert sich als Puppenspieler, der alle Fäden in der Hand hat, er beansprucht für sich die anachronistische Position des allwissenden, allmächtigen Erzählers. Die Figuren tun ihr Möglichstes, um ihn in die Schranken zu weisen, doch bleiben ihre Bemühungen am Ende vergeblich: Gleich zweimal betritt eine diabolische Gestalt die Bühne des Geschehens, die der Erzähler vorgibt, nicht erfunden zu haben, und die eigenmächtig in den Lauf der Handlung eingreift. An anderer Stelle beschließt die groteske Figur des Technikers Mollwitt, die Aufmerksamkeit des Autors Leo Richter auf sich zu lenken, um zum Protagonisten einer seiner Geschichten zu werden. Er scheitert – scheinbar – kläglich: „Alles geht weiter wie immerschon immer. In einer Geschichte, das weiß ich jetzt, werde ich nie sein.“ Wir aber wissen es besser: Seine Geschichte trägt den Titel „Ein Beitrag zur Debatte.“ Der Autor? Daniel Kehlmann.
Die Ärztin Elisabeth wiederum kommt dem Autor auf die Schliche; aufgrund schlecht recherchierter Fakten begreift sie, zur Spielfigur in einer seiner Geschichten geworden zu sein und droht, ihn zu verlassen. „Aber nicht jetzt,“ antwortet er gelassen: „Nicht in dieser Geschichte.“ Und auch wenn Kehlmann diese Worte Leo Richter in den Mund legt, fehlt jegliche Distanzierung des realen Autors von seiner Figur, sodass dessen Selbstdarstellung als Artifex Divinus selbstgefällig und eitel wirkt.
Besonders augenfällig wird dies in der „theologischen“ Erzählung „Rosalie geht sterben“. Rosalie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs und nur noch wenige Wochen zu leben. So beschließt sie, selbstbestimmt – nein, fremdbestimmt, der Erzähler ihrer Geschichte will es so – aus dem Leben zu scheiden. Ihrem Flehen um Gnade schenkt dieser zunächst kein Gehör, schließlich, so Walter Benjamin, ist „der Tod […] die Sanktion von allem, was der Erzähler berichten kann. Vom Tod her hat er seine Autorität geliehen.“ Doch am Ende wirft der Erzähler von Rosalies Geschichte diese bloß geliehene Autorität leichtfertig weg. Aus einer sentimentalen Laune heraus schenkt er ihr Gesundheit, Jugend und Schönheit, in der Hoffnung, „dass dereinst einmal jemand dasselbe für [ihn] tun werde“: „Denn wie Rosalie kann ich mir nicht vorstellen, dass ich nichts bin ohne die Aufmerksamkeit eines anderen, ja, dass meine bloß halbwahre Existenz endet, sobald dieser andere den Blick von mir nimmt.“
Ob Rührung und Pathos, ob Melancholie, Parodie oder Satire, alles in diesem Buch wirkt so dick aufgetragen wie die Theaterschminke der Schauspieler am Berliner Ensemble, es fehlt ihm an Subtilität, an leisen Tönen, an feingesponnenem Gewebe. Der ostentative Gestus, mit dem Kehlmann wiederholt auf die formale Kunstfertigkeit seines neuen Werks referiert, trübt nicht nur den Genuss des Lesers an dem intratextuellen Spiel, sondern vermag außerdem nicht darüber hinwegzutäuschen, dass der avancierte Versuch, einen Roman in neun Geschichten zu komponieren, scheitert. Die einzelnen Geschichten verflechten sich letztlich nicht zu einem geschlossenen Roman, dazu mangelt es den Querverweisen an Stringenz. Das Auf- und Abtreten der einzelnen Figuren und auch die spiegelbildliche Anordnung der Geschichten folgen allein der logischen Verknüpfung von Ursache und Wirkung und verdichten sich nicht zu einem organischen Ganzen. „Ein Roman ohne Hauptfigur“ sollte es werden. „Die Komposition, die Verbindungen, der Bogen, aber kein Protagonist, kein durchgehender Held.“ Ein ehrgeiziges Formexperiment, in Ansätzen durchaus gelungen, doch hat Kehlmann darüber leider das Erzählen vernachlässigt. So gerät ihm in Ruhm die Kunst des Erzählens zu einem denkbar artifiziellen Konstrukt.