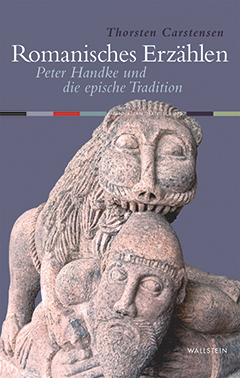Sich mit einer Dissertation an Peter Handke zu wagen, bedeutet nicht nur, diesen Brückenschlag zwischen Leben und Werk immer neu auszuloten, sondern impliziert auch ein gewaltiges Pensum an Lektüre, der Primärliteratur und der ebenso ausufernden Sekundärliteratur, eine Aufgabe, an der schon manche gescheitert sind. Thorsten Carstensen, Assistant Professor of German an der Indiana University-Purdue Indianapolis, hat das Wagnis auf sich genommen, herausgekommen ist eine beachtenswerte Arbeit: ein schönes Buch, ein ruhiger, weit ausführender Text, der die poetologisch diffizilen Wege Handkes nachzeichnet, eine originelle und wichtige Studie.
Den Bildverlust wolle er „romanisch erzählen“, notierte Handke in seinem Skizzenbuch Gestern unterwegs während eines Aufenthalts im November 1987 in Split, zu Beginn seiner Reise um die halbe Welt, die fast drei Jahre dauerte und eine entscheidende Zäsur im Werk des Autors darstellt. Denn mit ihr setzten Handkes Hinwendung zur Romanik und seine Versuche eines „romanischen Erzählens“ ein. Carstensens Ausgangspunkt ist die Einsicht, dass die Romanik Handkes Vorstellung von Kunst zu entsprechen scheint, „die in einem Gestus der Schlichtheit beständig auf existentielle Basisfragen und mythische Bilder zurückkommt, um diese aus wechselnden Perspektiven darzustellen und sie mit neuen Facetten anzureichern“ (20). Um dieses utopische, da nicht verwirklichbare „Projekt eines rein epischen Erzählens“ (22) an den bisher letzten langen Prosatexten Handkes auszuführen, holt Carstensen in den ersten Kapiteln weit aus und vollzieht die literarische Entwicklung Handke mit ihrem Wendepunkt der Langsamen Heimkehr nach – wobei er zugleich auch die jeweiligen Stationen der literaturwissenschaftlichen Debatten über den Autor referiert.
Die Handkeschen Grundthemen teilt Carstensen in drei große Komplexe. Der erste ist die Sehnsucht nach Teilhabe und die daraus resultierende „sentimentalische Weltaneignung“, die in den meisten Figuren angelegt sei, denen die „Erfahrung eines grundsätzlichen Mangels“ (40) gemeinsam ist. Der zweite Komplex ist das epische Erzählen, dem Handke seit seinen ersten Texten auf der Spur ist. Carstensen schließt an andere Studien an, wenn er konstatiert, dass Handke erzählen wolle, jedoch keine Geschichten, sondern die Möglichkeiten von Geschichten, ein Erzählen „ohne Handlung, ohne Intrige, ohne Dramatik, und doch erzählend“, wie es der Autor in der Geschichte des Bleistifts selbst ausgeführt hat. Mit seiner apsychologischen Erzählweise, gerichtet gegen die großen Romanentwürfe der Moderne eines Thomas Mann, Robert Musil oder James Joyce, versuche Handke, durch „das erzählerische Arrangement der Wirklichkeit den Blick auf Verbindungen, Analogien und Zusammenhänge [zu] eröffnen“ (106). So lenkt er die Aufmerksamkeit auf den Gestus des Erzählens, der sich immer wieder selbst versichert und ins Bewusstsein ruft. Zugleich trachte Handke danach, „moderne Subjektivität mit dem kollektiven Anspruch des Epos zu versöhnen, indem er für die erzählte Wirklichkeit einen ganzheitlichen Horizont reklamiert“ (111). Der dritte Komplex ist für Carstensen schließlich die „epische Suche nach der Kindheitslandschaft“ (119), die das ganze Werk durchziehe, besonders augenfällig natürlich in Die Wiederholung.
Nach diesem Streifzug durch das Werk und seine Deutungen entwirft Carstensen die Grundzüge des „romanischen Erzählens“. Handke bezeichnete in Am Felsenfenster morgens die Romanik als „die größte Epoche der Menschheit (der europäischen)“, und sie wird ihm in der Folge einerseits zu einer Traditionslinie, die das „Vergnügen an den Vorstellungen einer anderen Zeit beflügelt“, andererseits „Ausdruck jener Begegnung von archaischer Naturhaftigkeit und modernem Formwillen“ (150), die dem schriftstellerischen Ideal des Autors entspricht. Sein Zugang ist dabei nicht kunsthistorischer Natur, sondern beruht auf der intuitiven Anschauung vor Ort. Die Darstellungen auf den Portalen romanischer Kirchen verweisen für Handke auf Grundkonstellationen des menschlichen Seins, ihre Formen werden ihm „das Wahre“.
Carstensen betrachtet Handkes Zugang zur Romanik von mehreren Seiten. Er verweist auf einen Aspekt, den man sozial oder auch politisch nennen kann und der seine Wurzeln in der Kindheit des Autors hat. Denn Handke stellt die Romanik, die für ihn die „Dorfheimat“, das Kollektive vertritt, der Gotik gegenüber, die er als königliche Propaganda, als Repräsentantin des Machtapparats zwar nicht verwirft, aber doch geringschätzt. Tatsächlich ist die Romanik in der europäischen Kulturgeschichte der erste Stil, der in mehr oder weniger großer formaler Einheit das damalige Europa überzog und vom Volk getragen wurde. Diese Vorliebe ginge, so Carstensen, auf Handkes Kindheit zurück und auf ein „im Kern spätromanisches Bauwerk“ (156), nämlich die Stiftskirche in seinem Geburtsort Griffen, die Handke am Beginn der erwähnten Reise gleichsam zur Versicherung aufsucht. Die romanischen Skulpturen sind für ihn „Wahrzeichen einer peripheren Landschaft, die ohne ‚weltliche Herrschaftszeichen’ auskommt“ (160), auf eine vormoderne Art beinahe demokratisch oder ein „gemeinsamer Atem“, wie es in Gestern unterwegs heißt.
Als Kunstwerke besitzen die romanischen Skulpturen für Handke Modellcharakter. Sie sind laut Carstensen einerseits „mythische Reinformen“, die die verlorene Geschichte aufbewahren, andererseits „verkörpern sie zu Bildformeln verdichtetes Erzählen“ (164), das dem Autor als Vorbild für die Erneuerung der epischen Traditionen gilt. Und sie ermöglichen ihm den „Blick in die Tiefen der Geschichte, der grundlegende Erkenntnisse über das Wesen des Menschen heraufbefördert“ (170). Romanisch zu erzählen heißt für Handke auch, Menschen „mit dem phänomenologischen Blick zu erfassen“ (171), also unpsychologisch und überindividuell, bedeutet, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen darzustellen, die vorgefundene Realität nicht durch mimetische Abbildung wiederzugeben, sondern sie „in der Kraft der Imagination“ (179) aufgehen zu lassen.
Im Einklang mit diesem ideellen Bild der Romanik sieht Carstensen auch andere Grundkonstellationen des späten Handke. So etwa die in den Texten vorgeführte „anmutige, entschleunigte Teilhabe des Ichs an der Welt“ (189), die in der Figur des Fußgehers (eher als im Fußgänger, wie ihn Carstensen nennt), der durch Steppenlandschaften und Stadtrandgegenden wandert, ihren besten Ausdruck findet.
Diese Poetik der Langsamkeit ist an zwei Schlüsselbegriffen festzumachen: an dem der Schwelle als Ort des Innehaltens und an der Wiederholung, die als wesentliches Organisationsprinzip für Wahrnehmung und Schreiben einen „dauerhaften Weltbezug gewährleisten soll“ (191). Als den eigentlichen Anspruch des Autors stellt Carstensen seinen Wunsch dar, „an einem romanischen Epos des Friedens zu arbeiten, das die Welt so vorerzählt, wie sie sein sollte“ (189).
Handkes episches Ideal ist nicht die Abbildung der Wirklichkeit, sondern trachtet sie neu hervorzubringen, indem er die „Vielzahl disparater Eindrücke zu Konstellationen ausrichtet“ (209), die den Unterschied zwischen Wahrgenommenem und Phantasie bewusst verwischen und sich so in einem Bereich zwischen verschiedenen Wirklichkeitsebenen bewegen, wie sie am deutlichsten wohl in den Landschaften seiner letzten Bücher zu sehen sind, die in ihrer Mischung aus realen und erfundenen Geografien nicht mehr eindeutig zuzuordnen sind. Carstensen vollzieht diesen Prozess der Aneignung von Traumlandschaften überzeugend nach. Doch ist es schade, dass er kaum auf Handkes Texte zum Jugoslawienkrieg eingeht, da diese durch ihren expliziten Realitätsbezug die herausgearbeiteten Charakteristika relativieren und in etwas anderem Licht zeigen würden.
Im letzten Drittel schließlich spielt Carstensen diese Themen an den großen Romanen des Handkeschen Spätwerks durch, arbeitet bei ihnen aber auch neue Aspekte heraus. So zeigt er etwa bei Mein Jahr in der Niemandsbucht die Wiedergeburt des Autors, dessen Weg in abseitige Örtlichkeiten und seine Entmystifizierung des Erzählens. Die Ausfahrt und Heimkehr des Apothekers von Taxham aus In einer dunklen Nacht ging ich aus meinem stillen Haus wird bei Handke zur mittelalterlich inspirierten Aventüre. Anhand des Epochenproblems des Bildverlusts reflektiert Carstensen über das innere Abenteuer des Unterwegsseins und die Phantasie der longue durée, um schließlich über das Abenteuer des Erzählens im Don Juan zur Poetik des Hörens und Handkes Revision der Erzähl- und Lebensthemen in Die morawische Nacht zu gelangen.
Alles in allem ein umfassender, umseitig belesener und analytischer Gang durch das Werk Handkes, der bedenkenswert und nicht nur dank seiner geglückten Analyse des romanischen Schreibens für die Handke-Forschung von Bedeutung ist.