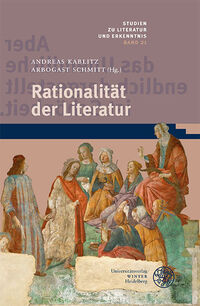Es ist das Verhältnis des (literarischen) Werks – also des „Endlichen“, Einzelnen und Individuellen, wenn man so will – zu dem, was es repräsentiert (d. h. darstellt und vielleicht auch vertritt) – dem „Unendlichen“ und Allgemeinen. Dieses Verhältnis spiegelt sich in einer speziellen Problemlage von Poetologie und Ästhetik als Disziplinen der Untersuchung von literarischen wie künstlerischen Werken wider, die spezifisch für diese Disziplinen ist und an der sich die Beiträge des Buches abarbeiten: Wie kann die wissenschaftliche (sprich: rationale) und auf Gemeinsamkeiten, Muster und Strukturen abzielende Erfassung des Werks das in ihm und durch es Dargestellte (das Individuelle, das Nicht-Begriffliche) auf den Begriff bringen?
Das genannte Verhältnis hat nicht nur die Antike oder die idealistischen Ästhetiken des 18. und 19. Jahrhunderts beschäftigt, sondern auch unterschiedliche (Literatur-)Theorien des 20. Jahrhunderts wie Hermeneutik, Marxismus oder Strukturalismus – mit unterschiedlicher Gewichtung: Hielten die einen das Individuelle, das Ereignishafte des Werkes für tendenziell unzugänglich (was zwangsläufig dazu führt, die Bemühungen und Möglichkeiten rationaler, d. h. wissenschaftlicher Zugänge zu Literatur und Kunst für nicht allzu weitreichend einzuschätzen), so betonten die anderen die Leistungen von Rationalität und Abstraktion und rückten die Struktureigenschaften von Werken in den Vordergrund (was ihnen von den ersteren den Vorwurf einbrachte, nicht adäquat mit Kunst und Literatur umzugehen). In der Tendenz sind die Beiträge des Bandes eher bei den ersteren zu finden.
Was dabei an der einen oder anderen Stelle ein bisschen untergeht, ist die Tatsache, dass man das Problem des Verhältnisses von Begrifflichem und Nicht-Begrifflichem bzw. von Allgemeinem und Individuellem nicht nur hermeneutisch-philosophisch mit Hilfe der ‚üblichen Verdächtigen‘ aus Philosophie und Ästhetik (Platon, Aristoteles, Lukrez, Horaz, Baumgarten, Kant, Schiller, Schlegel, Hegel, Heidegger, Adorno, Gadamer …) perspektivieren könnte, sondern auch erkenntnis- respektive zeichentheoretisch mit Wissens- und Symboltheorien, die die Spannung zwischen Sagbarem und Unsagbarem nicht an der Unmöglichkeit festmachen, das Individuelle nicht auf den Begriff bringen zu können, sondern an der grundsätzlich nicht unüberwindbaren Schwierigkeit, sinnlich Wahrgenommenes wie rational Gewusstes in Sprache zu übersetzen. (Man denke etwa an John Dewey, Ernst Cassirer, Ludwig Wittgenstein, Michael Polanyi oder Susanne Langer.) Mag sein, dass dies nur eine geringfügige Perspektivenverschiebung wäre, aber diese würde doch deutlich machen, dass die Schwierigkeiten der rationalen und wissenschaftlichen Explizierung oft auch mit Sprachkompetenz, irreduzibler Komplexität oder dem Widersprüchen zwischen Implizitem (etwa: Regeln genau wissen und exakt anwenden können) und Explizitem (Regeln aus welchen Gründen auch immer nicht angeben wollen oder können) zu tun haben. Nicht alle schweigen aufgrund von Ursachen, über die Literaturwissenschaft, Ästhetik oder Philosophie Auskunft geben könnten.
Im ersten Beitrag des Sammelbandes (Die Wahrheit der Kunst als petitio principii ihrer selbst – Martin Heideggers Der Ursprung des Kunstwerks) arbeitet sich Andreas Kablitz an Heideggers Kunstwerkaufsatz ab. Kablitz‘ Fundamentalkritik macht es sich nicht leicht und hebelt Heideggers Text nicht durch einen Bezugnahme auf die nationalsozialistischen Überzeugungen seines Autors aus, sondern geht den schwierigeren Weg (und dies mit überzeugender argumentativer Stringenz): Kablitz weist nach, dass sich Heideggers Argumentation – die als Zugang zur Wahrheit der Kunst das unvermittelte, nicht-begriffliche und nicht begreifbare Sinnliche und somit die „Kunst als Organ der Wahrheit“ (S. 14) jenseits rationaler Zugänge stark machen will – auf reine (und zudem teils widersprüchliche) Behauptungen stützt, die Heidegger unbegründet so setzt, „daß sie schlicht voraussetzen, was sie nachzuweisen antreten“ (S. 35).
Jan Urbich versucht sich in seinem Beitrag „Warum braucht es eine Theorie poetischer Gründe? Prolegomena zu einer inferentialistischen Philosophie poetischer Rationalität“ an einer Philosophie, die auf Literatur wie Kunst gleichermaßen zutrifft, also nicht zwischen poetisch und ästhetisch unterscheidet (S. 40). Dabei bezieht er sich nur auf gelungene Kunstwerke, „ohne zu erklären, was damit genau gemeint ist“ (ebd.). Gemeint sind auf jeden Fall Werke der „ästhetischen Moderne […], die auf den Begriffen von (relativer) Kunstautonomie, der regulativen Idee der Individualität von Ausdruck und Gestaltung, gesteigerten formensprachlichen Ansprüchen sowie der modernen Institution ‚Kunst‘ beruhen“ (S. 41). Auch wenn diese Einschränkung auf gelungene Kunstwerke nicht nur Zirkelschlüssen zu unterliegen droht, sondern auch aufgrund der fehlenden Erklärung für die Abgrenzung von gelungen und misslungen unbefriedigend bleibt, liefern Urbichs Ausführungen über ästhetische Rationalität nicht nur eine überzeugende und differenzierte Definition ästhetischer Rationalität (vgl. S. 42 u. 43), sie buchstabieren auch das komplexe Verhältnis aus von diskursiver Philosophie und propositionalem Wissen auf der einen Seite, intuitiver Kunst und phänomenologisch-praktischer Erfahrung auf der anderen. Urbich greift für seine Argumentation – darum trifft der oben formulierte Vorwurf auf ihn dezidiert nicht zu – auf Symboltheorien (etwa eines Nelson Goodman oder Arthur Danto) zurück, um zwei gängige Annahmen philosophisch fundierter Ästhetik zu widerlegen, die da lauten: Literatur würde nichts behaupten und daher keinen Wahrheitsanspruch formulieren; Literatur und Kunst würden auf nichts Wirkliches referenzieren. Dies ist deshalb unrichtig, weil literarische Kunstwerke „holistische Aussagen zweiter Ordnung darüber [sind], mittels welcher Sprachspiele, Diskursregeln, semantischer Muster und rationaler materialer Schlussbeziehungen uns Wirklichkeit praktisch und theoretisch zugänglich, verstehbar, erkennbar und verhandelbar wird“ (S. 59). Und darum ist ein literarischer Text eine Aussage über die geschichtliche Wirklichkeit einer Zeit.
Gideon Stiening widmet sich „Hegels ‚Logik‘ der Kunst“, so der Untertitel seines Beitrags, der als Titel ein Hegelzitat voranstellt: „Das Schöne ist durchweg der Begriff“. Hegels Ziel, so heißt es in der Einleitung des Bandes, sei es gewesen, „eine philosophische Bestimmung der Schönheit und der Kunst vorzulegen“ (S. 9); Stiening analysiert nun den Prozess dieser Bestimmung und greift dabei Hegels Vorlesungen zur Ästhetik hinsichtlich einer ihrer zentralen Thesen auf, nämlich jener „von der Kunst als Realität des Begriffs“ (S. 87) bzw. Kunst als „Scheinen des Begriffs“ oder „sinnliches Scheinen der Idee“ (S. 90). Folgerichtig gilt es, zuerst einmal den Begriff des Begriffs, zu klären, was Stiening in wünschenswerter Klarheit auch macht. Er macht auch klar, „daß es ‚die‘ Vorlesungen über Ästhetik von Hegel nicht gibt“ (ebd.) und gibt Einblicke in die Editionsgeschichte der von Hegel in Berlin in den 1820er Jahren gehaltenen Vorlesungen.
Mehr editorische Sorgfalt hätte dem Beitrag von Stiening gut getan: Es finden sich viele Tippfehler (einige durchaus ‚anregende‘ darunter wie etwa jener von der „selbstsändigen Existenz“) und Flüchtigkeitsfehler, leider auch in Hegelzitaten. Dass man von „verlaßen“, „klaßischen“, „Faßungen“, „Paßage Paßage [sic!]“, „erfaßen“, „befaßen“, „befaßenden“ usw. liest – und das findet sich nicht in Hegelzitaten –, mag ja noch angehen, nahezu unverständliche Sätze (etwa: „Alles eine Widerspruch enthaltene ist nicht bzw. Nichts. Konkreter läßt sich Gehels alternatives Verständnis […] erfaßen“ (S. 94) – das steht alles genau so da) sind dann doch ärgerlich.
Arbogast Schmitts Ausgangspunkt sind die Thematisierungen des Verhältnisses von Allgemeinem und Individuellem in den Dichtungstheorien der Antike, vor allem Aristoteles (von den drei ‚Großmeistern‘ Aristoteles, Horaz und Pseudo-Longinus) wird ausführlich gewürdigt. Schmitt erinnert daran, dass die Aristotelische Poetik (und jene von Horaz noch viel mehr), eine Poetik einer rational begründbaren Nachahmung ist und sowohl Produktion wie Interpretation von Literatur als „rationaler Erkenntnisvorgang“ (S. 105) gedacht werden muss. Auch wenn die Schrift des Pseudo-Longinus Über das Erhabene im 16. Jahrhundert durchaus Erwähnung finden mochte, so prägte die Neurezeption der aristotelischen Poetik in dieser Zeit doch die Poetiken bis ins 18. Jahrhundert hinein – und dies trotz der vielfachen Thematisierung von vorreflexivem „Geschmack, bon goût, common sense, bon sens, Urteilskraft, Gefühl“ (S. 106), deren Treffsicherheit im 17. und 18. Jahrhundert nur den erfahrenen Kennern zugeschrieben wurde und als letztlich immer begründbare Urteile galten. Erst Baumgarten brach mit dieser Vorstellung, allerdings auch nicht auf so radikale Weise, so Schmitt, wie man in der Regel meint. Dies beachtend können auch die Reaktionen auf Baumgarten (von Kant und Hegel über Schiller und Meier bis zu Arno Holz) neu perspektiviert werden, was zu einer spannenden Homer-Relektüre von Schmitt führt. (Die Lektüre von Schmitts Beitrag ist nicht nur ob seiner Verständlichkeit und präzisen Darstellung der Argumentation sehr lohnend, sondern auch aufgrund der Tatsache, eine Fülle von poetologischen Texten vorzustellen, die heute teilweise nur mehr Experten*innen bekannt sind.)
Gerhard Regn geht „Tassos Poetik des Heldenepos“ (S. 157) nach als einer Verbindung des aristotelischen Wahrscheinlichkeitskriteriums mit einer Ästhetik des Wunderbaren, die Tasso religiös argumentiert: Der Dichter dürfe „Übernatürliches dann einbringen […], wenn es nach christlichen Vorstellungen seine Wirkursache in Gott hat, oder dieser seine Agenten (Engel, Heilige oder Weißmagier) in seinem Namen auf den Plan treten lässt“ (S. 159). Regn zeigt aber, dass bei Tasso selbst das Wunderbare wieder in eine Poetik des Rationalen eingebettet wird. „Denn die ontologisch glaubwürdigen meraviglie, deren Fundament der Verweis auf die Existenz übernatürlicher Wirkmächte (Gott, Engel, Heilige, Weißmagier bzw. Dämonen, Schwarzmagier, Zauberinnen, Hexen) ist, kommen für einen poetologischen Aristoteliker wie Tasso nur dann zur vollen Entfaltung, wenn sie zum Teil einer Handlungslogik werden, die den Gesetzen von Notwendigkeit und Wahrscheinlichkeit gehorcht.“ (S. 172) Man könne also von einer „Naturalisierung des Wunderbaren“ (ebd.) sprechen.
Maria Moog-Grünewald untersucht „Die Rationalität der Vollkommenheit“, so der Titel ihres Beitrags, und weist dabei nach, dass „Vollkommenheit als ein Kriterium von Rationalität selbst erachtet werden [kann]. Das gilt für Theologie, Philosophie, Ästhetik und Wissenschaft gleichermaßen. Die Literatur wird die Probe aufs Exempel sein.“ (S. 181) Ihr Ausgangspunkt ist Schlegels radikale Schrift Über das Studium der griechischen Poesie, die bekanntlich vor allem „dem Zustand der gegenwärtigen Dichtkunst und weit mehr noch dem Entwurf einer künftigen Poesie“ (ebd.) gewidmet ist und die Moog-Grünewald mit Platons Timaios verschaltet. Schellings und Brunos Poetologien werden der Position Schlegels gegenübergestellt, wodurch Moog-Grünewald zeigen kann, dass „Schellings Kunstbegriff […] im Unterschied zu Schlegels Dichtungstheorie für weite Teile der Kunst und der Dichtung, der Literatur der Moderne von Belang [ist]“ (S. 192). In anderen Worten: Schlegel (wie auch Kant) mögen elaborierte Kunsttheorien entwickelt haben, die literarische wie ästhetische Praxis spricht allerdings eine andere Sprache. An Baudelaires Les Fleurs du Mal und an Prousts Recherche kann Moog-Grünewald dies überzeugend exemplifizieren.
Martin Endres befragt die „Rationalität der Interpretation“ (S. 199) mittels Selbstreflexion, indem er mit einer Form der „Selbstbefragung“ seines „philologischen Tuns“ (ebd.) beginnt. Endres stellt dabei fundamentale Fragen, die er vor allem durch textimmanente Betrachtung zu beantworten versucht – nicht immer befriedigend, was auch daran liegen mag, dass die Kategorien (Strukturiertheit, Ordnung oder Logik eines Textes; Einheit eines Zusammenhangs etc.) und Definitionen, mit denen er hantiert, vage bleiben. Die Anwendung des theoretisch Erarbeiteten auf E.T.A. Hoffmanns Ritter Gluck wirkt doch etwas übertrieben detailliert und überakzentuiert. Dass sich, um nur ein Beispiel unter vielen zu nennen, mit dem Satz „da setze ich mich hin“ aus Ritter Gluck – der Satz bezieht sich auf einen Caféhaustisch an einem schönen Spätherbsttag in Berlin – ein Ich im Sinne Fichtes „selbst setzt und zugleich gesetzt wird“ (S. 211), leuchtet nicht wirklich ein.
Wilhelm Schmidt-Biggemann greift in „Welche Rationalität, welche Literatur?“ weit und ins Grundsätzliche aus. Ausgehend von einer Definition der Begriffe Urteil, Wahrheit, Referenz und Widerspruchsfreiheit, Syllogistik, Dialektische Logik, Modallogik, Zweckrationalität und Plausibilität fragt er, wie man „Geschichtsschreibung“ und „Geschichten als Schöne Literatur“ voneinander abgrenzen kann – beide erzählen, und „die Erzählung [ist] die einzige Gattung, die Zeit darstellen kann“ (S. 232) – und wozu die beiden ‚Gattungen‘ eigentlich dienen. Geeint werden sie durch den Anspruch, das „Unverfügbare […] durch Form zur Erscheinung“ (S. 238) zu bringen, getrennt sind sie durch unterschiedliche Anforderungen an Referentialisierungsmöglichkeiten, die Schmidt-Biggemann mit dem Begriff der Kompossibilität (vgl. S. 233) und durch Rückführung auf (modal)logische Argumente ausbuchstabiert. Demnach liege die Geschichtsschreibung irgendwo „zwischen philosophischer Rationalität und schöner Literatur“ (S. 242). Das Fazit des Autors: „Wenn es stimmt, daß das Ästhetische etwas zeigt, das jenseits der strikten Begriffsverwaltung steht, und das eben nicht rekonstruierbar ist, dann ist es eben schön, daß es so ist. Wie sollte man sonst das Besondere des Schönen erfahren?“ (S. 242)
Der letzte – kurze, (manchmal polemisch) zugespitzte und sehr lohnende – Beitrag von Joachim Küpper stellt eine altbekannte Frage, die viele, die sich mit Literatur auseinandersetzen, mehr oder weniger oft und mehr oder weniger unterschwellig umtreibt: „Warum sich (professionell) mit Literatur beschäftigen?“ Für die Frage, warum das Lesen literarischer Texte lohnt, hat Küpper durchaus bekannte Antworten bereit, die zu lesen immer noch spannend ist, vor allem dann, wenn man sie rhetorisch so exzellent aufbereitet wie Küpper. Die Antworten changieren zwischen Kant und Freud, zusammengefasst lauten sie so: „Diese, die Literatur, gibt uns das, was uns das reale Leben unter zivilisierten Bedingungen nicht zu geben in der Lage ist, sei dies das ‚freie Spiel der Vermögen‘ [Anm.: die Position Kants ist diesbezüglich, so Küpper, die avancierteste Position], das in der wirklichen Existenz zugunsten der Zweckhaftigkeit eingeschränkt, wenn nicht unterdrückt werden muß, sei es die – zumindest imaginäre – Erfüllung von Triebwünschen [Anm.: dafür steht Freuds Dichtungstheorie aus dessen Aufsatz Der Dichter und das Phantasieren], die unter den genannten Bedingungen so stark tabuisiert sind, daß es uns noch nicht einmal gestattet ist, ein Bewußtsein von ihrer Existenz zu gewinnen […].“ (S. 243) Dass wir es dabei gewissermaßen mit einem Erziehungs- und Verdrängungsprogramm mit beträchtlichem Distinktionsgewinn für bürgerliche Eliten zu tun haben, deutet Küpper unfreiwillig an, wenn er meint, dass „kein Jurist, Mediziner oder auch Ingenieur aus der Generation noch meiner Eltern“ – Küpper ist Wikipedia zufolge Jahrgang 1952 – „in Zweifel gezogen [hätte], daß es sinnvoll ist, Dante, Shakespeare, Cervantes und Goethe zu lesen“ (S. 244).
Mit der Frage nach dem Sinn professioneller Beschäftigung mit Literatur hat Küpper weit mehr Mühe, rutscht er bei seinen Antwortversuchen doch unwillkürlich immer zurück in die Frage, warum man literarische Texte lesen solle. Aber doch arbeitet er zwei, wie ich meine, unverzichtbare, Antworten heraus: Es gehe zuerst einmal darum, Literatur, ihr spezifisches ‚Funktionieren‘ und ihre unverzichtbare Rolle für die Gesellschaft „systematisch zu analysieren und das Ergebnis solcher Analyse allgemein zugänglich zu machen“ (S. 247). Die Analyse müsse, vereinfacht formuliert, all jene überzeugen, die literarisches Lesen für verzichtbaren Luxus halten. Diese Überzeugungsarbeit ist heute, wo mit Sprache wie nie zuvor manipuliert wird und Literatur als Einübung in den kritischen Gebrauch der Sprache wie nie zuvor nötig wäre, schwieriger und notwendiger als sie es jemals war. Die zweite Antwort ist partikularer und richtet sich vor allem an die „sehr selbstbewußten“ und „zuweilen ein wenig naiven […] Historikerkollegen“, die meinen, dass Geschichtsschreibung ausreiche, wenn man Menschen mit Vergangenheit konfrontieren und solchermaßen zukunftsfähig machen möchte. Küppers zufolge reicht das nicht aus, denn „faßbar ist die geschichtliche Dimension unserer Existenz dem Nicht-Fachmann nur in ihren großen Bögen, d. h. in […] hochverdichteter Form“ (S. 250). Und diese Verdichtung könne die Geschichtsschreibung nicht leisten, das schaffe nur die Literatur.
Martin Sexl, geboren 1966 in Hall/Tirol, Studium der Vergleichenden Literaturwissenschaft, der Germanistik und der Spanischen Philologie an der Universität Innsbruck und in Granada (Spanien), Auslandsaufenthalte in Spanien, Südamerika und Frankreich, Doktoratsstipendium in Paris, Professor am Institut für Vergleichende Literaturwissenschaft der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck. https://www.uibk.ac.at/vergl-litwiss/personen/martin_sexl/