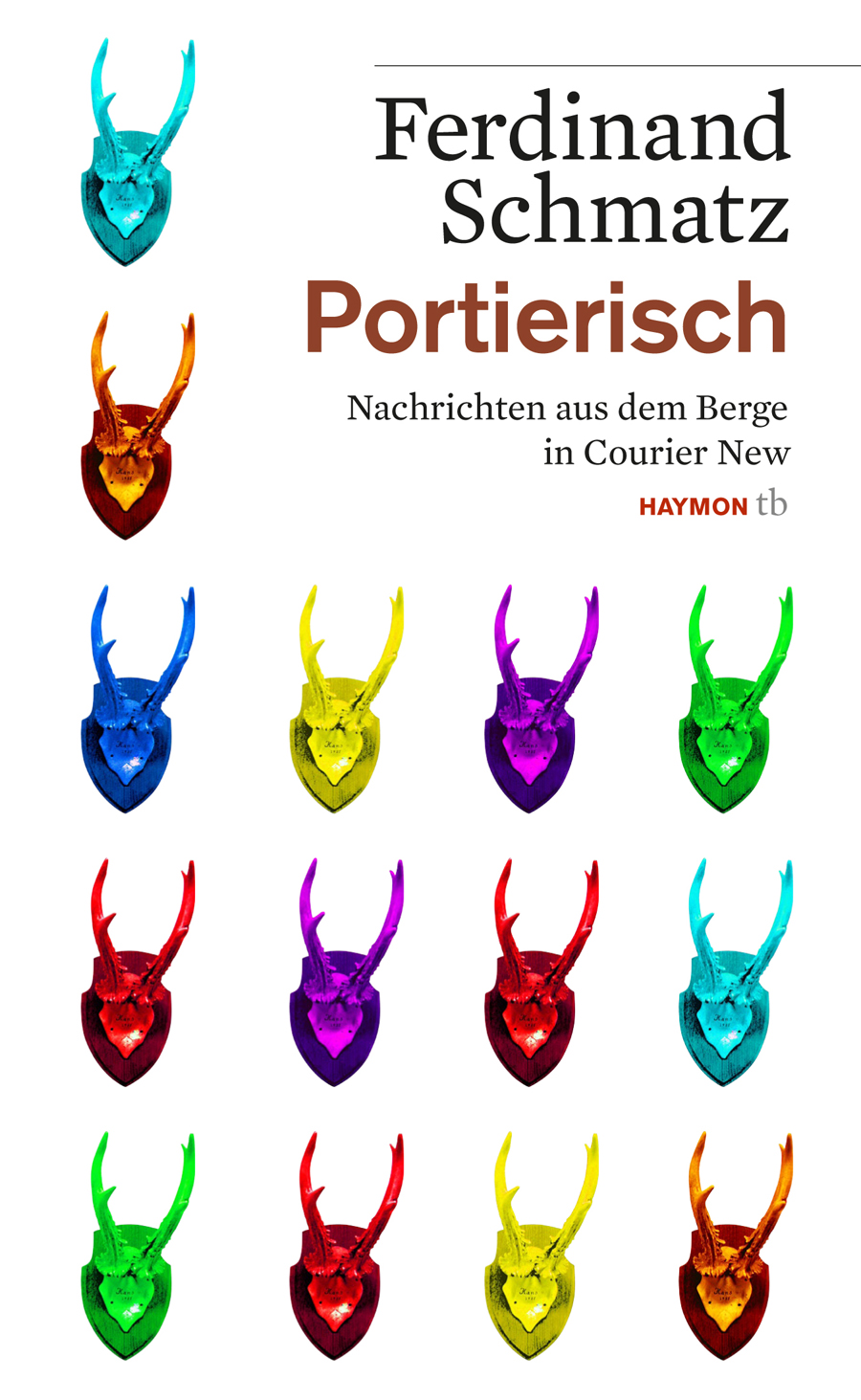Der vor allem als Lyriker profilierte Autor, der Sprachreflexionen in wortgewaltige Höhen zu treiben versteht, hat sich diesmal über die Form des Romans hergemacht. Mit offensichtlichem Genuss hat er sie ausgeweidet, das Stoffliche einer Art von Heimatroman und dessen herkömmliche Gestaltungsmöglichkeiten fein säuberlich separiert und neu wieder arrangiert wie eine gemalte Stelze auf dem Präsentierteller eines Stilllebens. So ist eine Prosa entstanden, die ihr Heil nicht in einem „bekennerhaften Erzählen“ (Wendelin Schmidt-Dengler) sucht, sondern keinerlei Eindruck mehr erweckt, Wirklichkeit ließe sich lückenlos reproduzieren, das heißt: in den Griff kriegen; und die Leser werden mit einem widersetzlichen Werk konfrontiert, in dessen Aussagestruktur das Inkohärente und Fragmentarische als konstitutive Elemente berücksichtigt sind.
Das Bemerkenswerte allerdings, von dem anfangs die Rede war, bezieht sich vor allem darauf, dass das Ergebnis des permanenten Changierens zwischen Narration und meta-diskursiven Verfremdungen gut zu lesen und über weite Strecken sogar ausgesprochen unterhaltsam ist. (Der Witz des Ganzen erschließt sich übrigens noch deutlicher, wenn man die Gelegenheit hat, den Autor seinen Text selbst vorlesen zu hören!). Portierisch haftet trotz aller experimentellen Raffinesse, die ihm zugrunde liegt, nicht die übliche Bemühtheit vieler künstlerischer, philosophischer oder psychologischer Erörterungen der Vernetzungen von Bewusstsein, Sprachvermögen, Weltverständnis und Informationsvermittlung an. Ferdinand Schmatz, ausgestattet mit einem gerüttelt Maß an Selbstironie, hat sich vielmehr einen Spaß daraus gemacht, Faktisches auf eine Weise aufzubereiten, dass einerseits weder ein sogenannter Schlüsselroman noch eine Autobiographie dabei herausgekommen ist, andererseits aber durchaus der Eindruck entsteht, man erfahre dennoch viel Persönliches aus der Vita des Ich-Erzählers, der den bezeichnend verschleiernden Namen „Kuss“ trägt. Symptomatisch für das hier angewandte Verfahren ist auch der eigentümliche, assoziationsfördernde Buchtitel (tierisch, Porta/Tür, Träger/Zuträger…), der – aus jedem syntaktischen Zusammenhang gerissen – grammatikalisch unbestimmt bleibt zwischen adverbialer und prädikativer Bestimmung. Zugleich begründet die Offenheit des Begriffs eine Spannung, die auch aus den unterschiedlichen Rollen der beiden Hauptfiguren resultiert.
Kuss befindet sich zu Beginn der Handlung im entlegenen „Fustritztal“ (S. 5), dessen topographische Beschreibungen unschwer auf das steirische Feistritztal schließen lassen, einen Landstrich zwischen Fürstenfeld und Weiz. Ihm zur Seite gestellt ist ein ständiger Begleiter, der Amerikaner „Courier“, der die „Spuren jenes Philosophen“ verfolgt, „der sich in dem Ort weiter unten, vor dem Pass aufgehalten haben soll“ (S. 6). Courier, dieser Schrift- und Schreibtyp, Agent für zum Druck bestimmte Texte, fungiert als Personifikation von Formulierungsprozessen ins Reine; er ist Medium, Produktionsmittel und Stichwortgeber, Ausgangs- und Angelpunkt für eine ungeheure Fülle von lautmalerischen Verballhornungen, Sprachspielen, mehr oder weniger absurden Gedankenketten und hermeneutischen Zirkelschlüssen, Stabreimen, Metaphern und etymologischen Ableitungen, die den Stil dieses Buches prägt. Die verbale Spontaneität, die erheischt wird, hat freilich Methode, denn die praktizierte Abfassung von Denkvorgängen, Wahrnehmungen und Gefühlen bleibt (in bester Wittgensteinscher Manier) transparent im Hinblick auf ihre Konstruiertheit, auf ihre Künstlichkeit und Mechanik im Sinne eines letztlich notwendigen Rückgriffs auf vorhandene sprachliche und literarische Modelle, um kommunikationsfähig zu sein.
Daher erfahren wir einmal mehr, gleichsam im Zustand schöpferischer Begriffsstutzigkeit, wie es zugeht auf dem Land: Die österreichische Gentry (wie beispielsweise in Person des Gutsherrn Zup) hat ihren privilegierten Status immer noch inne und umgibt sich gerne mit Künstlerprominenz, die ihrerseits bestrebt ist, im elitären Rahmen eines Keramik-„Symposions“ (S. 21f.) Kunst als gesellschaftliches Ereignis zu definieren. Die weiteren Episoden des Romans, sofern der Inhalt überhaupt Relevanz besitzt, ergeben sich aus dem Figureninventar, das man im Zusammenhang mit dörflichen Geschichten längst zu kennen meint. Ein Ferment in diesem System bleibt bis zuletzt der Ich-Erzähler, dessen kleinbürgerliche, eben „portierische“ Herkunft aus dem Hausmeistermilieu Wiens den Blick für das Bestehen sozialer Hierarchien schärft.