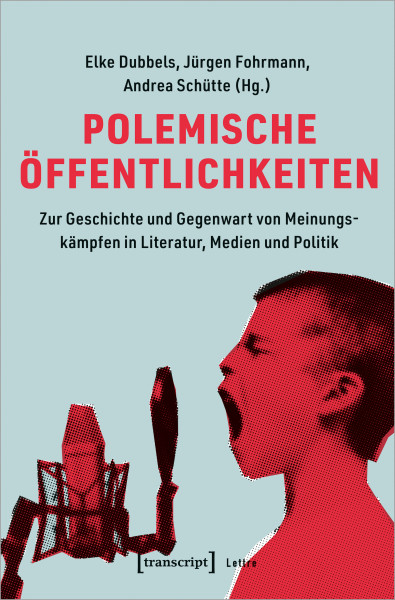Überraschender will scheinen, wo er – so kritisiert die Mitherausgeberin Andrea Schütte in ihrem Beitrag zum Buch „Polemische Öffentlichkeiten“ – die Grenze zwischen guter und schlechter Polemik ausmachte: exakt entlang der Mediendifferenz zwischen analogen und digitalen Medien nämlich. In der gedruckten Polemik seien, so wird Billers Befund zitiert (aber auch simplifiziert), „die Sätze komplizierter, die Beschimpfungen elaborierter, die Kritiken […] durchdachter“ als in der „Hass- und Hetz-Atmosphäre im Internet“.
Der Geschichte und Gegenwart von Meinungskämpfen in Literatur, Medien und Politik widmet sich der vorliegende Sammelband. Man könnte, verführt durch diesen Untertitel und auch das poppige Cover (das Umschlagbild greift übrigens auf die Bebilderung von Billers Zeitungstext zurück), einen unterhaltsamen Streifzug durch allerlei prominente Querelen und Scharmützel des 20. Jahrhunderts darin vermuten. Tatsächlich ist es den Verantwortlichen um anderes zu tun: Es geht im Kern darum, in mehreren interdisziplinären, theoriegeleiteten Anläufen den „Stellenwert der Öffentlichkeit für die Polemik“ und zugleich die „Bedeutung der Polemik für die Struktur historischer Öffentlichkeiten“ auszuloten (S. 8).
Einen theoretischen Orientierungspunkt bildet dabei Ernst Manheims Unterscheidung zwischen transzendentaler Öffentlichkeit, dem Leitbild der bürgerlichen Öffentlichkeit der Aufklärung, einerseits und pluralistischer Öffentlichkeit, dem Öffentlichkeitstypus der Weimarer Republik, andrerseits (neben, drittens, der qualitativen Öffentlichkeit des Zensurregimes).
Steht Polemik (von griechisch pólemos ‘Krieg, Streit’) in der Idealvorstellung des 18. Jahrhunderts noch im Dienst der „Prüfung und Klärung der eigenen und der Positionen anderer im Rahmen einer auf Diskussion setzenden Wahrheitsheuristik“ (S. 9), so ist sie in der pluralistischen Öffentlichkeit von einem Erkenntnismittel zu einem Mittel der Polarisierung geworden: Es geht nun um die Vertiefung der Differenzen – nicht soll der Gegner überzeugt werden, nicht soll die Wahrheit aktiviert werden, sondern mobilisiert werden soll das Publikum, das denn eben auch „nicht als erhabener, rational urteilender Richter, sondern als mobilisierbare Menge adressiert wird“ (S. 10).
Freilich sei Polemik, so wenden Dubbels und Schütte einleitend gegen Manheim ein, auch in der Zeit der Aufklärung nicht auf ihre epistemische Funktion beschränkt gewesen, gehe es doch „immer auch um kulturelle Deutungshoheit und um die literatur- und medienpolitische Behauptung gegenüber der Konkurrenz“ (S. 11). Das betrifft gerade auch den literarischen Markt, auf dem sich der freie Schriftsteller als Autorität etablieren und identifizierbar machen muss. Was die Moderne anbelangt, spreche vieles dafür, deren massenmediale Öffentlichkeit mit Niklas Luhmann als grundsätzlich „polemogen“ zu beschreiben, werde doch in ihr unentwegt um Aufmerksamkeit gerungen – und genau dafür bilde der Konflikt ein effizientes Mittel.
Mit der Geschichte ändern sich laufend „die Konfliktmodelle, die Diskursregeln, die politischen Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten der Teilhabe, die Medien und die Praktiken der öffentlichen Auseinandersetzung“ (S. 11). Auch die Öffentlichkeit diversifiziert sich, was Tribunalisierung und Mobilisierung Vorschub leistet. Es lohnt daher in der Tat, die Zusammenhänge zwischen Polemik und Öffentlichkeit(en) in mehreren „historische[n] Probebohrungen“ (S. 15) zu erforschen und die Erkenntnisse darüber zu vertiefen, wie es die Beitragenden des vorliegenden Bandes unternehmen.
Die Bohrungen sind erfreulich weit gestreut und erweisen sich größtenteils auch als ergiebig. Sie reichen thematisch von den Polemiken Jakob Michael Reinhold Lenz’ gegen Christoph Martin Wieland (Johannes F. Lehmann, S. 21–45) und jenen von Heinrich Heine gegen Madame de Staël und Rousseau (Dorothea Walzer, S. 75–97) bis herauf zu den feministischen Öffentlichkeiten rund um die Zeitschriften „Emma“, „Courage“ und „Die Schwarze Botin“ (Karolin Kupfer, S. 141–164), wobei zu kritisieren wäre, dass an diesem Punkt die Polemik zwar sichtbar ist, aber nicht zum Gegenstand der Analyse wird, sowie zwei Aufsätzen zum Populismus (Niels Werber, S. 185–203 / Giancarlo Corsi, S. 205–221).
Ein Artikel verfolgt diachrone Entwicklungen anhand der Textsorte des Manifests, ausgehend von der Frühen Neuzeit über die Französische Revolution und das Kommunistische Manifest bis zum Dadaismus (Jürgen Fohrmann, S. 99–118), ein anderer unternimmt einen waghalsigen Zeitsprung: Die Medienkritik von Karl Kraus wird hier mit den Postings von Stefanie Sargnagel querverbunden (Rupert Gaderer, S. 119–140), und ein weiterer setzt sich mit der Rolle der Polemik in der Etablierung und Entwicklung der literarischen Öffentlichkeit auseinander (Dirk Rose, S. 223–247).
Wie unterschiedlich Polemik schon im 18. Jahrhundert funktionieren konnte, zeigt Elke Dubbels Beitrag zur „Publizistik der Mainzer Republik im Kontext der Kämpfe zwischen Aufklärung und Gegenaufklärung“ (S. 47–73). Der radikale Aufklärer Karl Friedrich Bahrdt wendet sich 1788 öffentlich gegen das zeitgenössische „Wöllner’sche Religionsedikt“. Findigerweise lässt er in seiner satirischen Komödie „Das Religions-Edikt“ jedoch anstelle des preußischen Ministers Johann Christoph Wöllner einen gewissen Pfarrer Blumenthal, buchstäblich ein „besofnes [sic] Schwein“, als Verfasser des Gesetzes auftreten und gibt diesen dem Spott preis.
Bahrdt erweist sich in seinem Text als wahrer Meister der Polemik: Der politische Gegner wird von ihm seitenlang zitiert, feinsäuberlich widerlegt, als hilflos vorgeführt und moralisch diskreditiert. Blumenthal zeigt sich im Stück als seinen Gesprächspartnern unterlegen und verweist sie etwa, wo er von ihnen auf die Widersprüchlichkeit seines Entwurfs aufmerksam gemacht wird, kurzerhand des Raums oder wird überhaupt handgreiflich. Gerade Bahrdts Kunstgriff, nicht den politischen Gegner selbst, sondern einen Stellvertreter namentlich auf die Bühne zu rufen, gewährleistet dabei, so führt Dubbels überzeugend aus, dass die intendierte Sachkritik am Religionsedikt von der persönlichen Diffamierung nicht verdeckt wird.
Wie ganz anders dagegen die Polemik, der sich Bahrdt 1790 mit August von Kotzebues Lustspiel „Doctor Bahrdt mit der eisernen Stirn“ selbst ausgesetzt sah: Er wird darin als abgewirtschafteter „Hurenwirth in Halle“ inszeniert, die mit ihrem bürgerlichen Namen auf die Bühne gestellten Aufklärer geben sich sexuellen Ausschweifungen hin und richten sich aus niedrigen Motiven – Neid und Geldgier – gegen den Schriftsteller Johann Georg Zimmermann. Beim Phallus der indischen Gottheit Schiwa versammelt man sich zum Schwur (Verschwörungsmotiv!), bevor man in einer konzertierten Aktion und ohne Skrupel medial gegen den Feind zu Felde zieht.
Die Welt hat sich seit Ende des 18. Jahrhunderts umfassend gewandelt, und doch wird man beim Lesen der Beiträge vielfach verblüffende Parallelen zur Gegenwart entdecken können. Um eine sachliche Dimension, so Dubbels, braucht sich die „Bahrdt“-Schmähschrift nicht zu kümmern, weil sie an einer kritischen Diskussion gar nicht interessiert ist, „sondern gegen die aufgeklärte kritische Öffentlichkeit selbst polemisiert“ (S. 61). Dubbels Beitrag zeigt nebenbei auch, dass Polemik schon lange vor der heutigen Netzöffentlichkeit auf die Stufe des Hetzens und Denunzierens reduziert sein konnte. Über die sprachliche Elaboration ist damit freilich noch nichts gesagt.
Damit zum eingangs schon erwähnten Beitrag von Andrea Schütte (S. 165–183): Darin werden in produktiver Weise interessante Überlegungen zur „Netzpolemik“ und deren medialer Logik angestellt. Dass die von den Regeln des Netzes vorgegebene Sprachverknappung und Content-Vermassung den „Zwang zur deutlichen, ja: überdeutlichen, hervorstechenden und aggressiven Rede“ (wiederum: Aufmerksamkeitskampf!) mit sich bringe (S. 174) und Polemik eine bewährte Methode sei, Sprache entsprechend zu markieren, ist ein nachvollziehbarer Befund. Ein zweiter, dass – und ähnlich wird das, unter Rückgriff auf Luhmann, an mehreren Stellen des Bandes festgehalten – Polemik deshalb so durchschlagskräftig ist, weil sie, ähnlich wie die Moral, stets ad personam zielt.
Vielleicht etwas zu optimistisch erscheint hingegen doch Schüttes abschließende These, dass polemische Kommunikation, wie wenig elaboriert und „wie stammelnd auch immer formuliert“, in verdeckter Form stets „Strukturschwächen“ aufzeige, „die wunden Punkte einer Gesellschaft offenlegt“ und „kritisches Potential“ enthalte. „Wo polemisiert wird, muss analysiert werden. Das ist das kognitive Angebot, das billige Polemik liefert.“ (S. 180)
Dass sich durch Interpretation dessen, was im Netz auf der Ebene polemischer Kommentare steckenbleibe, allenthalben etwas gewinnen lassen würde, mag eine tröstliche Vorstellung sein. Doch so wenig der intellektuelle Unterschied zwischen „Donald Trumps nächtliche[n] Twitter-Angebereien“ (Biller) und „den verbalen Ein- und Ausfällen eines Heinrich Heine [oder] eines Karl Kraus“ (ebenfalls Biller) ein Produkt der Mediendifferenz sein dürfte – was Biller denn auch keineswegs behauptet –, so schwer dürfte es werden, jenen ein „kritisches Potential“ oder einen „kognitive[n] Zugewinn“ (S. 182) abzuringen.
Wenn Biller in Schüttes Beitrag Schwarzweißdenken unterstellt wird (gute Druckpolemik, schlechte Netzpolemik), so wird dabei die Stoßrichtung seines Artikels erstaunlicherweise völlig verkannt: Der Autor richtet sich nicht (was müßig wäre) gegen die Verbalaggressionen im Internet, sondern gegen die Behäbigkeit des Feuilletons, die heuchelnden Beruhigungspillen der Leitartikel und die moralische und intellektuelle Trägheit, mit der die deutsche Öffentlichkeit dem schleichenden Abgleiten in den Extremismus gegenüberstehe.
Biller fordert geistige Beweglichkeit und kritischen Verstand ein und propagiert, dass nur eine Sprache, die herausfordere, die „Denk-Attentat[e]“ begehe und Dinge beim Namen nenne, Menschen mobilisieren und unser Denken verändern könne. Und man darf wohl zwischen seinen Zeilen lesen, dass nur sie zugleich dem Extremismus das Wasser abgraben könne.
Dem Hetzen im Netz spricht Biller den Status von Polemik vielmehr glatt ab: „Hass, Polemik und einfach mal Pöbeln sind nicht dasselbe“, bringt das eine Bildunterschrift zum Artikel auf den Punkt. Damit allerdings ist eine mögliche Differenzierung bezeichnet, die im Rahmen des vorliegenden Buches vielleicht etwas zu kurz gekommen ist. Ob unserer an Polarisierung und Atomisierung, an Geschrei und Aufmerksamkeitsdefiziten leidenden Gegenwart ein Mehr oder ein Weniger an Polemik guttäte, wäre im Übrigen eine diskussionswürdige Frage gewesen.