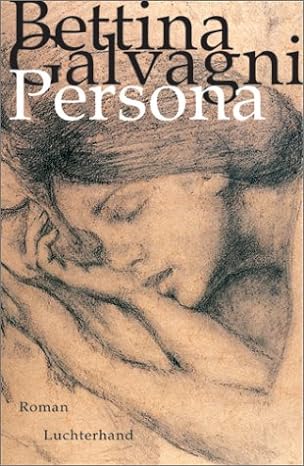Dass der Klappentext zu Persona noch die Markenbezeichnung „das Wunderkind der österreichischen Literatur“ führt, hat offenbar einige KritikerInnen erst recht zum Widerspruch gereizt und ihnen ein Stichwort geliefert: Nach den geradezu apotheotischen Echos auf „Melancholia“ sind die positiven Feedbacks nach dem Roman Persona weitgehend ausgeblieben, dagegen konnte das Wunderkind nun einige blaue Wunder der Kritik erleben. Dieses Begeisterungs-Enttäuschungs-Verhalten und der Übergang von vorbehaltlosem Lob zum glatten Verriss auf Seiten der Kritik ist ja nicht unbekannt und insbesondere in den letzten Jahren mit all den Fräuleinwundern keine Rarität.
Vor dem Hintergrund dieser Ereignisse soll hier ein Blick auf Persona geworfen werden, der von einigen immanenten Intentionen des Romans ausgehend sein Gelingen zur Diskussion stellt. Es stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis sich der Roman Persona zum Debüt vor fünf Jahren sieht? Im Gegensatz zu der betont autobiografischen Schul- und Krankengeschichte und ihrer Ich-Erzählerin in „Melancholia“ tritt in Persona die Hauptfigur Lori den LeserInnen in der dritten Person und in einem weit größeren Distanzverhältnis gegenüber. Obwohl das Ich in „Melancholia“ selbstverständlich konstruiert und sogar in einem hohen Maße stilisiert ist, spürt man in dem neuen Roman die Anstrengung der Autorin, sich von der Sprechweise ihres Erstlings, der durch seine rhetorische Unmittelbarkeit aufgefallen ist, wegzuschreiben.
Persona ist daher nicht allein distanzierter geschrieben, sondern auch sprachlich sorgfältiger sortiert. Hatte die Ich-Erzählerin in „Melancholia“ „keine Lust mehr, aufzupassen, daß die Wörter sich nicht in Stromschnellen metaphorisieren und allerlei Ufergestrüpp mitnehmen“, so hat es sich die Autorin in diesem Punkt inzwischen doch anders überlegt. Die nicht enden wollenden Partizipialkonstruktionen und die flutartigen Metaphorisierungen sind in Persona vergleichsweise stark zurückgedrängt. Dass aber Galvagnis Liebe zur exzessiven Anhäufung von Adjektiven oder zu ausgesuchten Vergleichen, kurzum ihr Hang zu einem Sprachgebrauch, der zwischen Anspruch und Prätention laviert, auch in Persona anzutreffen ist, scheint auf ein immanentes Dilemma zu verweisen. Es spielt in beiden Prosawerken eine tragende Rolle. So ist in „Melancholia“ ganz offen vom Schreiben als einem Akt der Befreiung die Rede, zugleich stellt die Ich-Erzählerin jedoch fest, dass der „Schreibzustand den Wirklichkeitszustand wie ein Leintuch“ zu bedecken droht. An einer Stelle sagt sie noch direkter von sich, dass sie „eine fürchterliche Angst (hat), daß die Sprache aufgehellt, gebleicht werden könnte, daß meine Hölle keine Hölle mehr sein würde und meine gleißende Apokalypse heller als sie war“. Die Sprache dient nicht nur als Vehikel der Befreiung, sie kann, und zwar im selben Moment, auch zum Hindernis für diesen Akt werden. Dieses Dilemma kennzeichnet auch Persona. Die Hauptfigur und Studentin Lori, die mit der Icherzählerin in „Melancholia“ mindestens verschwistert ist, besucht regelmäßig ihre Psychoanalytikerin Eliza in der Wiener „Geisterstadt“ Steinhof. Es wird nicht ganz klar, wovon sich die Protagonistin denn befreien will. Etwas hält sie davon ab, ihren traumatischen Erinnerungen gegenüberzutreten. Stattdessen scheint sie sich in Nebensächlichkeiten zu verheddern. Oder sie verliebt sich in ihre Analytikerin, von der sie – wie es ihr Arzt ausdrückt – am liebsten „eine makellose Kopie“ wäre, oder in Madame Elvira, ihre Französischlehrerin.
Was hält den Leser davon ab, Persona als Prozess einer schmerzhaften Aufarbeitung erschreckender Traumata zu lesen? Zwar gelingt es der Autorin bereits auf den ersten Seiten auf beeindruckende Weise, den Identitätsverlust Loris als Erosion ihrer Erinnerungen zu beschreiben, wenn sie sich etwa das Bild der „grauen Villa“ vor Augen führt: „Es war so schwierig, denn sie sagte: die graue Villa, und dann sah sie sie, während sie die Worte sagte und den kurzen Augenblick danach, sobald der letzte Buchstabe ins Nichts versunken war – aber wenn sie sich konzentrierte, sah ihr inneres Auge sie noch länger, und um sie zu behalten, zählte es alle die Dinge auf, die zu der Villa gehörten. Gegen Ende dieser Liste begannen die erstgenannten Dinge zu stürzen, als ob sie Dominosteine wären, und man mußte entweder neue Dominosteine aufstellen oder die alten zu einer Kette zusammenfügen, damit das Bild der grauen Villa nicht verlorenging …“ Der Zusammenhang von „grauer Villa“, die als das Vaterhaus ihrer Freundin Anne auch für das Grauen des sexuellen Missbrauchs steht, erschließt sich erst gegen Ende des Buches. Im letzten Drittel kommt, von Lori wie im Nebenbei erwähnt, eine Kette schockierender Ereignisse ans Tageslicht, die zweifellos zu einer Traumatisierung der Protagonistin beigetragen haben könnten: der Selbstmord ihrer an Depressionen leidenden Mutter, der sexuelle Missbrauch ihrer Jugendfreundin Anne durch deren Vater, ihr späterer Selbstmord. Die Erklärung, dass das nebensächlich Erwähnte psychoanalytisch gesehen die Hauptsache ist, will allerdings nicht befriedigen.
Der Schwierigkeit, sich zu erinnern bzw. sich mit dem eigenen Unbehagen auseinander zu setzen, geht die Protagonistin zu leichtfertig aus dem Weg. Es sieht so aus, als würde sie eine Rechtfertigung für diese Zurückhaltung aus einer Grundeinstellung der Entscheidungslosigkeit beziehen: „Ich nenne es Hybris, wenn ein Mensch bei zwei Sachen, die ihm allen Ernstes gleich viel bedeuten, sich entscheiden kann.“ Daher „gehe ich sehr sorgsam und mit Glacéhandschuhen mit meinen Entscheidungen um“. An diese Sätze der Ich-Erzählerin in „Melancholia“ vermag sich Lori in Persona zu erinnern. Der Lehrer, „Ulysses“, mit dem sie jetzt zusammen lebt, wollte sie einst mit der Sphinxfrage in die Enge treiben: „Wenn du leben und der Sphinx entgegentreten willst, mußt du Entscheidungen treffen.“ „Ein Rätsel zu lösen bedeutet, sich zu entscheiden.“ Gerade aber das Rätsel soll für Lori ein Modell einer offenen Identität verbürgen, in dem der Ambivalenz der Dinge, aber auch dem Geheimnis einer Person Raum gegeben wird. In pragmatischer Hinsicht erfüllt es wohl auch eine Funktion des Selbstschutzes. Dabei werden an der Oberfläche zwei Ebenen miteinander verknüpft, die keineswegs selbstverständlich aneinander gekoppelt sind. Loris Angst vor der Aufgabe des Rätsels vermischt sich mit der Angst vor der Aufklärung der Ursachen für das eigene Unbehagen. Zu sehr versteigt sich Lori in ihre Selbstverrätselung und -verdunkelung, die in ihrer Eigendynamik eine ungenügende Analyse ihres Zustandes zur Folge haben. Diese Verwechslung allerdings, und darin erweist sich eine grundlegende Schwäche des Romans, wird nicht oder zumindest nicht in einem entsprechenden Verhältnis als das Dilemma der Hauptfigur dargestellt.