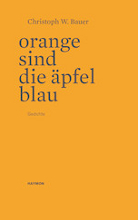Wie auch schon bem letzten ähnlichen Projekt Bauers im Haymon Verlag, der Veröffentlichung „getaktet in herzstärkender Fremde“ aus dem Jahr 2012 ist auch diesmal der literarische Bezugspunkt ein Dichterkollege, dessen Person und Werk sich der Autor in fünfzehn Gedichten zu nähern versucht. War es vor drei Jahren der spanischstämmige Schwarzwälder José F. A. Olivér, also ein unmittelbarer Zeitgenosse, so hat sich Christoph W. Bauer diesmal einen etwas älteren Meister über Zeit und Raum hinweg als lyrisches Gegenüber gewählt: den Andalusier Federico Garcìa Lorca.
Als Motto wählt Bauer die erste Strophe von Garcìa Lorcas 6. Casida aus dem posthum erschienenen Zyklus „El Divàn del Tamarit“. Das Spiel mit Formen, hier mit der ursprünglich aus der arabischen Literatur stammenden Gedichtform der Kasside (die Garcìa Lorca freilich nicht sehr streng übernimmt) ist gleichermaßen dem andalusischen Dichter wie seinem österreichischen Kollegen der Jetztzeit ein permanentes Anliegen. Das darin thematisierte Bild von der „verletzten Hand“ kann als Hinweis auf die stete Gefährdung lyrischer Existenz gelesen werden, die Bauer in seinem Schaffen unmittelbar wahrzunehmen scheint – auch darin ein Gleichklang mit dem spanischen Seelenverwandten, der die Veröffentlichung seines letzten Werkes nicht mehr erlebt hat, weil er von den Falangisten im August 1936 ermordet wurde.
Das erste Gedicht Bauers hat gleich zu Beginn den Bezug auf dieses Gefärdetsein zum Inhalt („da ist angst in deinem blick“, S.3), geht unmittelbar hinein in das Zwiegespräch mit dem toten Dichter, lotet den unterschiedlichen Erlebens- und Erfahrungshorizont aus und kommt zum unweigerlichen Halbschluss: „so/reduziert sich alles auf ein paar/zeilen zwischen dir und mir“ (ebd.).
In den folgenden Texten stellt Bauer seine eigene tirolerische Kindheit der andalusischen Garcìa Lorcas gegenüber: „keine/violen gab es nicht oliven/aber tannen herbeigezogen/auf dem akkordeon“ (S.4), heißt es da und „wohlbehütet unsere kindheit und mörderisch/ist jede zeit“ (S.5). Einerseits sind das bildreiche und poetisch fein versponnene Verse (man beachte nur beispielsweise das Anagamm violen/oliven). Doch auch ein fast schon kumpelhaft anmutender Ton dem älteren gegenüber ist immer wieder herauszulesen: „was/die sehnsucht absondert//ist vergebens und alles/flitter letztendlich amigo/authentisch ist’s allemal“ (S.7). Scheue Distanz ist Bauers Sache nicht, der auf seiner Homepage postuliert: „poetry is a punkrocker“.
Auch über den philosophisch-literarischen Ansatz direkt versucht Bauer seine Annäherung an Garcìa Lorca, begründet seine innere Zugewandtheit zu ihm mit Senecas „wir scheinen ruhig, doch wir sind es nicht“, eine Essenz, welche das lyrische Ich Bauers auch aus den Gedichten des Andalusiers herauszulesen glaubt. Die innere Unruhe wird so neben dem Gefährdetsein zu einer weiteren wichtigen Voraussetzung für dichterisches Schaffen erklärt.
Und so spinnt Bauer seine poetischen Texte fort, hinterfragt kenntnis- und anspielungsreich wie immer die spanische Literatur des 16. und 17. Jahrhunderts, verwickelt Garcìa Lorca gar in einen dichterischen Disput über dessen eigene Vorbilder („was war so golden am goldenen zeitalter“, S.11), nimmt Bezug auf die in New York verbrachte Zeit um 1929/30 („angekommen im körpereigenen/exil“, S.12) und auf sein Ende im Spanischen Bürgerkrieg („regime vergehen es bleiben die toten“, S.14). Bauer nutzt dabei souverän die ganze formale Tradition von Abend- und Morgenland: Anleihen an Terzinen und verschiedene Sonettvarianten, der Einsatz kunstvollen Enjambements und die bereits erwähnten arabischen Einflüsse werden bemüht, um ein lyrisches Feuerwerk zu entfachen, welches dem vielleicht größten spanischen Dichter des 20. Jahrhunderts und dessen eigenen stilistischen Charakteristika angemessen sein soll.
In Verbindung mit dem Christoph W. Bauer eigenen schnoddrig-intellektuellen Ton entsteht so einerseits eine kunstvolle Paraphrase auf Leben, Werk und Tod Garcìa Lorcas, die sich durch hohe sprachliche Originalität und formale Leichtigkeit auszeichnet, die aber andererseits auch Gefahr läuft, eine nicht immer hundertprozentig plausible Verknüpfung mit der literarischen Befindlichkeit des österreichischen Autors herzustellen. Das scheint dieser selbst zu bemerken, wenn er schreibt: „hey du wir beide sind doch zigeuner“ (S.15), um dann schließlich bekennen zu müssen: „nichts weiß ich von dir und/von deinen landschaften/hab keine ahnung woran/du verzweifelst“ (S.17).
Authentisch wirken all die handwerklich präzise gesetzten Kunstgriffe vor allem dann, wenn der Autor unmittelbar etwas über sein lyrisches Ich preisgibt: die herrlich wilde Reflexion über dessen Jugend mit heulenden Rockgitarren und der Aversion gegen das hippiehafte Gutmenschengeklampfe des Nachbarn etwa („von the clash hörte ich/zum ersten mal deinen namen/spanish weeks in my disco casino“, S.9) oder die Erinnerung an Tagträume („andalusien aus dem wort zog ich/wonach ich gierte unterm schnee/alpiner winter“, S. 10). Dies sind die Stellen, in denen Christoph W. Bauer zu großer Form aufläuft und die jetzt schon neugierig machen auf den nächsten Gedichtband aus seiner ureigenen „verletzten Hand“.