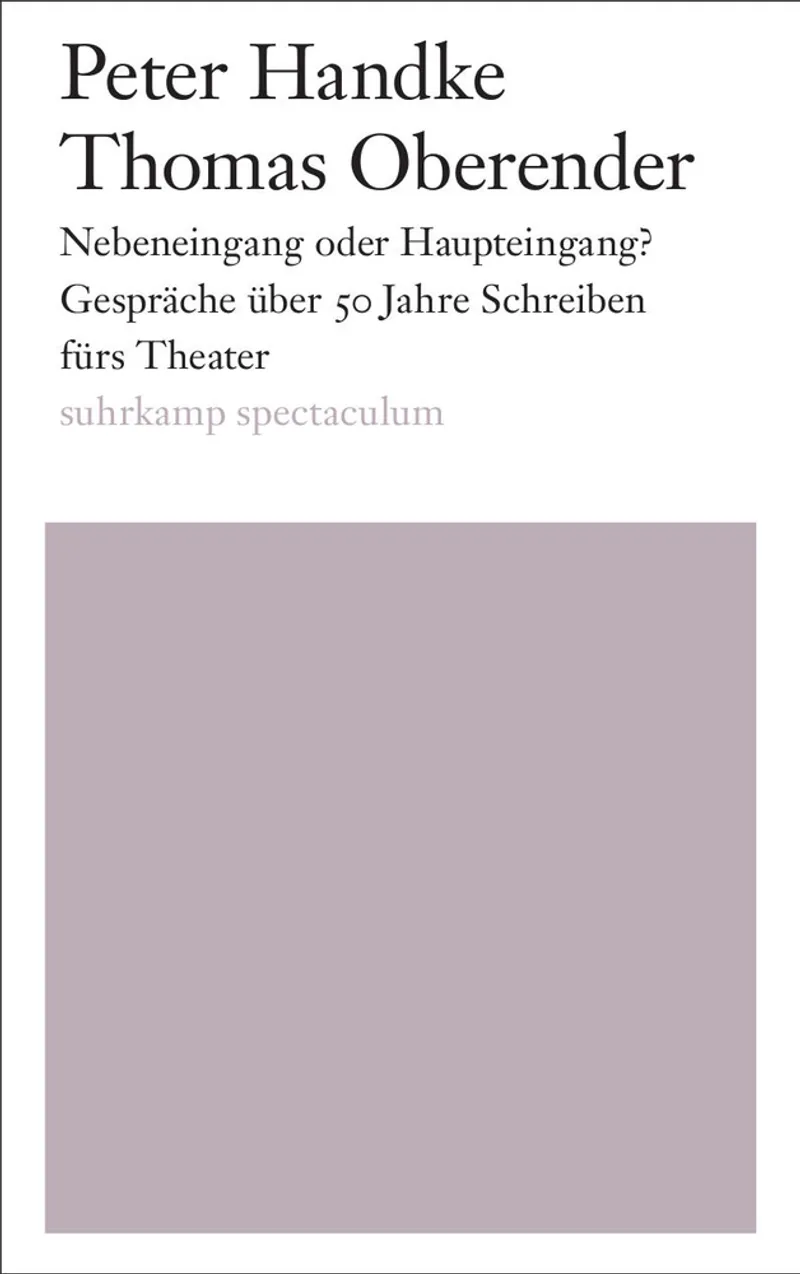Als Thomas Oberender gerade dabei ist, zu einer Art Überblick über das Bühnenschaffen Handkes auszuholen, unterbricht ihn dieser mit der Bemerkung, dass man doch »auch über Nebensächliches reden sollte« (S. 122), um dann von seinem kleinen Zimmer in Chaville zu reden, das er in der Nähe des Bahnhofes gemietet hatte vor vielen Jahren, um dort zu schreiben, und dies zu einer Zeit, als er noch mit der Schreibmaschine geschrieben hatte, und wie dann einmal … und diese kleine nebensächliche Geschichte, die neben vielen anderen solcher Geschichten in diesen Gesprächen zu finden ist, funktioniert wie ein »Wink« im Sinne Ludwig Wittgenstein, der in seinen »Philosophischen Untersuchungen« fragte: »Kann man Menschenkenntnis lernen? Ja; Mancher kann sie lernen. Aber nicht durch einen Lehrkurs, sondern durch ›Erfahrung‹. – Kann ein Andrer dabei sein Lehrer sein? Gewiss. Er gibt ihm von Zeit zu Zeit den richtigen Wink. – So schaut hier das ›Lernen‹ und das ›Lehren‹ aus. – Was man erlernt, ist keine Technik; man lernt richtige Urteile. Es gibt auch Regeln, aber sie bilden kein System, und nur der Erfahrene kann sie richtig anwenden. Unähnlich den Rechenregeln. Das Schwerste ist hier, die Unbestimmtheit richtig und unverfälscht zum Ausdruck zu bringen.« (Suhrkamp Werkausgabe Band 1, Frankfurt a.M. 1984, S. 574f.)
Handke-Leser/innen kennen das Unterbrochene und Unterbrechende, dieses Nachdenkende, Verharrende und Stockende, welches das Schreiben Peter Handkes zu einer Bewegung im Raum macht: »[D]ass sein Ausgangspunkt beim Schreiben nie eine Geschichte oder ein Ereignis, ein Vorfall sei, sondern immer ein Ort«, das meinte Peter Handke bereits Ende der der 1980er Jahre einmal, wie Oberender im Vorwort erwähnt (S. 9). Das Schreiben Handkes ist eine Bewegung, die die scheinbar unausweichliche Linearität der Sprache zu durchbrechen vermag, weil sie einmal schneller und dann wieder langsamer ist, weil sie stehen bleibt und zurückgeht, einen anderen Weg einschlägt, sich verirrt, Perspektiven verrückt. Und dies konsequent: »Ich werde mich entschlossen verirren«, zitiert Handke sich selbst aus den »Phantasien der Wiederholung« (S. 80). Dass die Bewegung des Schreibens von Handke immer mit Orten und Ortswechseln zu tun hat und dadurch in die Nähe der »bild-enden« Künste gerät, illustriert Handke selbst mit einer treffenden Stelle aus einem Brief von Paul Cézanne an dessen Sohn: »Ich gehe auf dem Weg zur Sainte-Victoire auf der Straße einen Schritt nach links und alles wird anders. Und einen Schritt nach rechts und ich sehe ein anderes Bild.« (S. 100)
Thomas Oberender gelingt es, diese Bewegung in jenen vier Gesprächen mit Peter Handke nachzuvollziehen, die er mit diesem im April und im September 2012 über dessen Theaterschaffen führte. Dass die Erzählungen des Nebensächlichen erfreulich selten und allenfalls andeutungsweise zu einer Attitüde gerinnen – was leider in recht vielen Interviews und Gesprächen mit Peter Handke, in denen Fans oder Jünger fragen, der Fall ist –, ist der Gesprächsführung des fast 25 Jahre jüngeren Oberender zu verdanken: Als bekannter und erfahrener Theaterregisseur und Intendant sinkt er nicht einmal in der Haltung des Jüngers vor dem Autor auf die Knie, sondern führt wirklich und wahrhaftig – und ab und zu auch frech – vier Gespräche, in denen kaum gefragt (und wenn, dann nicht nur von Oberender), sondern viel miteinander geredet wird, und dies wohltuenderweise kaum über Handke selbst, als vielmehr über dessen Arbeit.
Was die beiden dabei über das Theater Peter Handkes und über Schauspieler/innen, Autor/innen und Regisseur/innen von Aischylos bis Zadek reden, ist vielleicht gar nicht das Entscheidende, auch wenn es aus den vier Gesprächen eine Kiste voller wunderbaren Nebensächlichkeiten macht. Weit spannender erscheint (zumindest dem Rezensenten, der weit mehr ein Leser als ein Zuschauer ist), dass jene Arbeit sichtbar wird, mit der all die nebensächlichen Dinge in der Theaterkiste verfertigt werden: die Arbeit an der Sprache.
Handkes Texte stellen die Arbeit an der Sprache ohnehin immer aus, aber in den vorliegenden vier Gesprächen wird dies auch reflexiv begleitet. Dadurch werden die Gespräche zu einer Art Werkstattbesuch, bei dem Oberender – selbst einer, der sein Handwerk versteht (und dadurch nicht nur mitreden, sondern auch dagegenreden kann) – den Handwerker Handke durch die Werkstatt begleitet, ihm über die Schulter blickt und ab und zu eine Bemerkung einstreut, die Handke dazu bringt, sein mäanderndes Reflektieren explizit zu artikulieren. Dadurch werden diese Gespräche auch für diejenigen, die mit Handkes Theater weniger vertraut sind, zu einem aufschlussreichen Besuch in der Sprachwerkstatt (bei dem man allerdings bereit sein sollte, sich mit nötiger Langsamkeit zu bewegen). Und sie schaffen ein Bewusstsein für die versteckten Bedeutungsebenen der Sprache: Wenn Handke von »all den auffälligen Menschen heute« sagt, dass diese sich im Gegensatz zu einem (guten) Schauspieler »aufspielen« (S. 23), dann wird einem durch Handkes eigenen Kommentar – »Das ist ein gutes Wort« (S. 23) – der Konnotationsreichtum dieses Begriffs (und vieler anderer auch) deutlich. Man kann Handke beim Denken zuschauen: »Na ja, das ist ja ein Vorschlag, man kann sie auch Altötting nennen oder, ich weiß nicht, Bautzen oder, eher nicht.« (S. 50)
Oft wird die Arbeit an der Sprache nur für Leser/innen und nicht für Zuschauer/innen – »Unter hundert gibt es immer nur einen, bei dem man etwas spürt«, heißt es auf S. 36 über Theaterbesucher/innen ganz allgemein – deutlich. Das ist wohl ein Grund für die Fremdheit, die Peter Handke trotz bislang 21 Bühnenwerken dem Theater gegenüber immer noch empfindet (vgl. S. 10), und auch für seine Klage, dass heute die Stücke nicht mehr gelesen werden: »Und heute ist es sehr, sehr schade, fast ein Kummer, daß Theaterstücke nicht mehr zur Literatur, nicht mehr zum Lesen gehören, zur Welterfahrung oder Urerfahrung Lesen.« (S. 34) Denn beim Zuschauen droht jene Wahrheit, die beim Lesen Raum bekommt, durch Realismus oder gar Naturalismus überdeckt zu werden, einem Realismus, der die sichtbare und fraglose Existenz von etwas als »Beweis, dass es wahr ist« erachtet. »Wahr ist etwas anderes als so was.« (S. 120) Vielleicht ist die Herausforderung, Unsichtbares (Nebensächliches) auf der Bühne sichtbar zu machen, die Handke am Theater reizt, aber um dieses Paradox ästhetisch umsetzen zu können – sowohl auf der Bühne wie auch beim Schreiben –, dürfe man sich, so Oberender, »nie ganz hineinbegeben«. Und Handke darauf: »Man soll an alles rühren, nur nichts erklären, nur nichts ausschöpfen. Ein bißchen schöpfen schon, aber nicht ausschöpfen.« (S. 172) Dass das Verdikt über Bühnenwerke, die alles »auf den Punkt bringen wollen« (S. 136), auch das absurde Theater trifft, zeigt das Urteil über Becketts »Warten auf Godot«: »Warum die Bühne als symbolischen Ort benutzen fürs Existieren? Das kommt mir wie eine Tautologie vor. Das ist ja klar. Das muss man nicht noch extra symbolisieren.« (S. 65)
Über ein paar Banalisierungs- und Mystifizierungstendenzen (letztere sind nicht selten anzutreffen, wenn es um Handke geht) sieht man ob der Fülle an Informationen, Anregungen und wunderbaren Umwegen gerne hinweg, etwa über den Beginn des Vorworts (»Im Grunde haben wir nur im Garten gesessen und über das Theater geredet«, S. 9), über den »Morgenspaziergang durch die Rehwiesen unweit des Hauses«, von dem Handke mit einem »Strauch [sic!] Sauerampfer« (S. 9) zurückkehrt, über die herumliegenden »Herbst-« und »Gartenäpfel« (S. 11) oder über die ab und an eingestreuten Bemerkungen zum Gesprächsort (»Ah, ein gelber Falter! Ein Zitronenfalter ist gerade vorbeigeflogen!«, S. 37; »ein Eichhörnchen, da hinten!«, S. 54). Aber vielleicht gehört das auch zum vertrauten Rolleninventar von Gesprächen mit Peter Handke, wie es auch zum vertrauten Rolleninventar gehört, sich als Rezensent darüber zu mokieren, um nicht in den Verdacht zu geraten, Fan oder Jünger zu sein. (Wobei zu hoffen ist, dass zumindest Handkes Urteil über die Kritiker – »Die sind ja selber arme Hunde. Die wissen schon am nächsten Tag nicht mehr, was sie gelesen haben« (S. 55) – zumindest nicht auf den Rezensenten zutrifft.)
Gebrochen werden die genannten Tendenzen ohnehin, und zwar auf der einen Seite durch jene Form der Ironie über die eigene Sprachverwendung, für die das Schreiben und – vor allem – das Reden Handkes unter anderem steht. So heißt es etwa, um nur ein beliebiges Beispiel herauszugreifen, über ein Buch von Einar Schleef: »[D]as ist schon etwas wert. Einer meiner neuesten Lieblingssprüche: Das ist etwas wert. Dieses Buch war’s wert.« (S. 62) Auf der anderen Seite bricht Handke Tendenzen, zum Mythos seiner selbst zu werden, durch Selbstkritik und Widerstand gegen Fehl- oder Überinterpretation: »Ja, da ist ein bißchen eine verlogene Bescheidenheit in dem Text drin« (S. 63) oder »Das ist natürlich scheinheilig, was ich gesagt habe« (S. 83) heißt es da etwa über seine eigenen Worte oder »Das darf man nicht so theoretisieren oder schematisieren«, wenn Oberender Handke fragt, ob er sich denn als »der Cervantes Ihrer Leute« empfindet (S. 100).
Unterm Strich: vergnüglich und gewinnbringend!