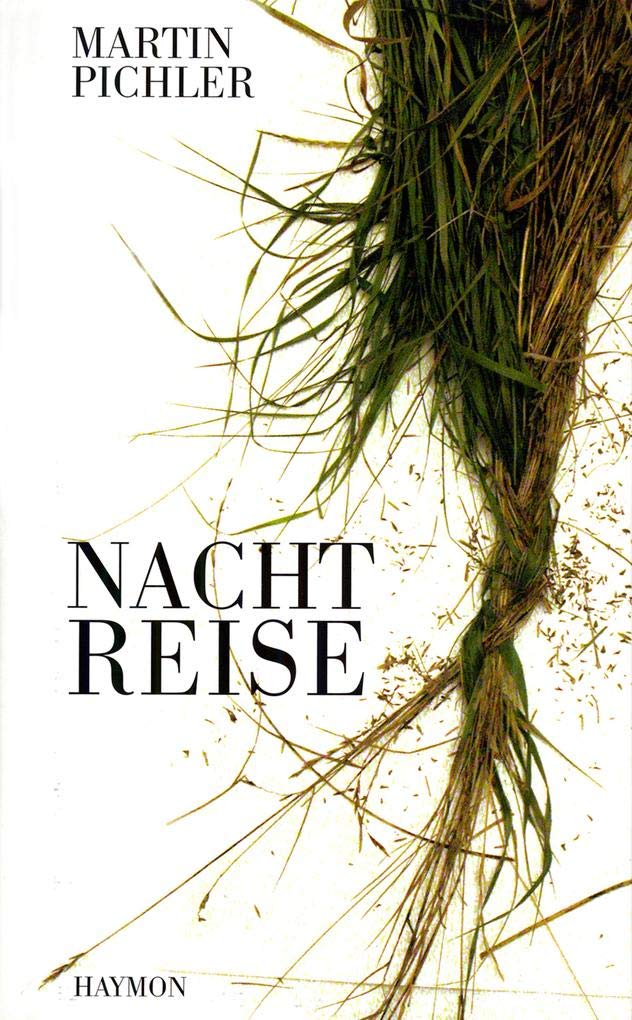Zwischen der Ausführung verinnerlichter Haushaltspflichten – „[…] sie liebt es so sehr, wenn alles aufgeräumt und blitzblank am richtigen Platz steht, dass es eine Augenweide ist“ – zeichnet der Erzähler anhand von Episoden aus Kindheit, Jugend und Ehe Magda Stofners Spuren nach. Im weiteren Verlauf der locker verknüpften Handlung gibt ihnen sodann Michael aus der Perspektive eines zuerst ablehnenden, dann zunehmend fürsorglichen Sohnes Gewicht, der seiner Mutter seine Homosexualität anvertraut und sich deshalb später schuldig fühlt, sie damit belastet zu haben. Zusehends verändern sich die Zeichen von Magdas Altern und Erschöpfung in jene einer Todeskrankheit, gegen die sie nicht anzukämpfen vermag.
Pichlers zweites Prosawerk Nachtreise setzt an den intensiven Passagen des letzten Kapitels von „Lunaspina“ an, in denen die Ohnmacht von Ehemann und Sohn zur bitteren Selbstanklage wird und Pichler in die Ich-Form wechselt. Das Zuhause ist zu einem Ort des Unheils geworden, zu einem Ort des Tag für Tag wachsenden Grauens. Wiederum schöpft das „Erzählen gegen den drohenden Verlust“ (S. 109) der an Brustkrebs erkrankten Mutter aus sinnlichen Sprachbildern, doch ist Pichlers mitunter mit Dialektausdrücken versetzte Sprache schlichter geworden, kleidet sich in kurze Sätze. Es wird nicht so sehr auf szenische und dialogische Momente geachtet, vielmehr auf eine kraftvolle und nicht abgegriffen wirkende semantische Verdichtung des Textes. Als sich die Mutter an einer Stelle darüber beschwert, im Krankenhaus „herumgeklaubt“ zu werden, vergleicht Pichler ihre Knochen beispielsweise mit Äpfeln: „Mutters Knochen schlagen wie in einer Klaubertasche hart gegeneinander, so werden sie geschüttelt.“ (S. 55)
Auch für den Autor ist es ein anderes Schreiben als beim letzten Roman vor dem Tod der Mutter: „Schon habe ich Angst die Einzelheiten zu vergessen, die Geschichte im Wiedererzählen zu verdrehen. Ich will die richtigen Namen nennen, keine Ausflüchte mehr. Die Erinnerung lässt kein Dichten und Erfinden mehr zu.“ (S. 138) Der Schrecken zieht die Wörter an. In der Ich-Form erzählt Martin Pichler weiter vom Familienleben im ländlich-klerikalen, konservativen Umfeld des Bozner Stadtteils Gries, dem seine Mutter sich allerdings schon vor Jahren entzogen hat. Die nach langem Verdrängen eingestandene Krankheit der Mutter lässt Versöhnung zu, wo es zuvor keine Verständigung gab. So kann die Mutter mit der Homosexualität ihres Sohnes mittlerweile gut leben und der Vorwurf des Vaters, sein Sohn sei ein „Blindgänger“ und gebe als Schriftsteller Pornographisches von sich, scheint müßig. Der erste Klinikaufenthalt bewirkt für kurze Zeit sogar eine dem Leben zugewandte Haltung der Mutter, die über verpasste Möglichkeiten klagt.
Auch spricht Martin Pichler nun offen darüber, dass er jahrelang davor zurückschreckte, sich seine Homosexualität einzugestehen: „Aus Scham kann ich den größten Verzicht leisten, der mir abverlangt wird, darin bin ich meiner Mutter ähnlich.“ (S. 105) Nur die Welt seiner Bücher, aus der sich seine Mutter wie durch einen Fluch ausgesperrt fühlte, ließ die Wahrheit zu, brachte die Hirngespinste seiner Angst zum Schweigen. Martin Pichler erwähnt Saul Bellow, Natalia Ginzburg, Marlen Haushofer, Peter Weiss und ganz besonders den Kärnter Autor Josef Winkler, dem sich Pichlers Prosa kongenial nähert, wenn auch seine Anklage zurückhaltender ist, wie er einmal selbst beobachtet: „Ich stoße an keine Wände, ich gehe nicht mit Fäusten auf Türen los, die abgeschlossen sind. Ich weiß, sie werden sich nicht öffnen lassen.“ (S. 117)
Das Leben zerfällt in zwei Hälften, in eine der Mutter zugewandte und in jene der Wahrheit, die der Mutter verschwiegen wird. In der Zeit nach dem Tod der Mutter, von der im zweiten Teil des autobiographischen Textes erzählt wird, rückt die Familie noch näher zusammen, überspringt familiäre Gräben, während der einfache Umgang mit Alltagsgegenständen – die Mutter half sich mit dem Wort „Wirbelwinder“, wenn ihr deren Bezeichnung nicht gleich einfiel – nun besonders den Vater aus der Bahn zu werfen droht.
Mit schonungsloser Konsequenz hat Martin Pichler, ein vielversprechendes Schreibtalent, ein beeindruckendes Prosawerk geschaffen.