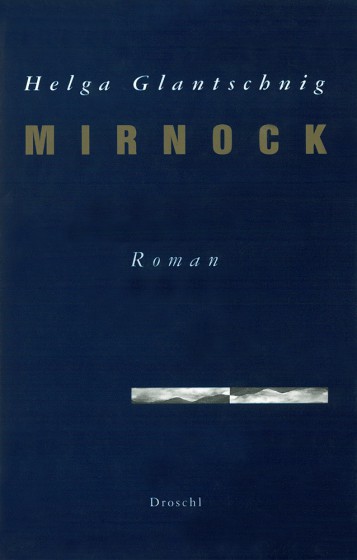In unspektakulärer, zurückhaltender Weise beobachtet und beschreibt Glantschnig das familiäre „Dickicht von Wärme“ (S. 17), sie erfaßt Gewöhnlichkeit in beeindruckender sprachlicher Intensität und Dichte. Nicht nennenswerte Ereignisse, Verrichtungen, Begegnungen wachsen zusammen zum Prozeß des Älterwerdens, des sogenannten Heranreifens. Vom braven Kind zum wohlerzogenen Mädchen zur fleißigen Schülerin zur jungen Frau zwischen Freßanfällen in der Speis, „Sexysein“ (S. 157) und „Unwohlsein“ (S. 138).
In den Keller geschickt werden, einkaufen geschickt werden, Erstkommunion, „Badedas“, „Stollwerck“, Kusinen, Schularzt, Firmung, Gräberbesuch zu Allerheiligen, Vorspielabend – das Gängige, das Übliche. Die kindliche Identifikation mit den Eltern und deren Tätigkeit als Lehrer färbt den Blick und prägt die Leidenschaft für Lesen und Schreiben: „Das Sauberwischen der Tafel, das Bekritzeln, Schraffieren, mit Leib und Seele dabei. […] Auch der Himmel eine Tafel, übersät mit Wolkenfetzen, verwischten Kreidezeichen.“ (S. 27). Mit den Jahren verwischt auch diese Identifikation und die damit verbundene Sicherheit mehr und mehr: vertuschte Kurzsichtigkeit, „Dulcolax-Dragees“, Modebewußtsein, Pubertät, Zweifel, Abgrenzung – das Gängige, das Übliche.
Daß diese rückblickend fixierte Normalität nie fad wird, liegt an der exzessiven Wahrnehmung. Glantschnig registriert minimale Zuckungen, die sarrauteschen „Tropismen“, und gibt sie in maximaler Auflösung wieder. Ihre Prosa hat alle Sinne beisammen. Rituale des Heranwachsens in der österreichischen Provinz bis herauf zur Ballnacht mit „Kneifen und Knutschen“ (S. 192) und Blutfleck am Kleid macht die Autorin in einer großartigen Kombination aus regionalen, zeittypischen und paradigmatischen Elementen fest. Die Genauigkeit, die Präzision der Erinnerung und die Kraft, auch dort, wo es sonst oft üblich ist und naheliegt, trotzdem auf unbestechliche Weise nicht zu werten – etwa den allgegenwärtigen Katholizismus oder die BDM-Erinnerungen der Mutter -, sind andere Stärken dieses Textes.
Die „Psyche“, der verspiegelte Toilettentisch, den Glantschnig in einer Schlüsselszene, in welcher das junge Mädchen die Veränderung ihres Körpers bemerkt, in gekonnt akzentuierter Symbolik einsetzt, verweist in der Verknüpfung von Bewußtsein und Materialität auf die „Lektion der Dinge“, so der Titel einer 1991 von Glantschnig herausgegebenen Anthologie verschiedenster Versuche einer „écriture féminine“.
Mirnock ist – mehr noch als eine weitere österreichische Autobiografie – nach Nathalie Sarrautes „Enfance“ wieder ein Buch über weibliches Aufwachsen, das in seiner radikalen Akkuratesse überzeugt, in seiner verhaltenen Intensität beeindruckt.