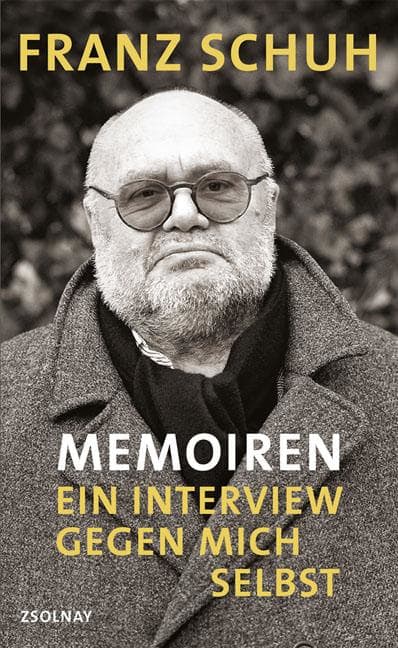Ein Interview gegen mich selbst lautet die paradoxe Vorgabe seiner „fiktiven Selbstbefragung“, bei der sich der Autor zu relevanten Themen äußert. Schuh als Ankläger und Verteidiger, als ich und er, das riecht nach Genre-Satire und perfider Leserübertölpelung. Nun, die Anhängerschaft des Wiener Vor- und Nachdenkers wird kaum überrascht sein, denn wer seine Essaybände öffnet, weiß, worauf er sich einlässt: eine Einladung zum Mitdenken, die freilich bisweilen in intellektuelles Armdrücken ausartet. Mit der ihm eigenen Neigung, sich dem Leben diskursiv anzunähern, verschafft er Einblick in die Welt des Geistes, wo Privates ganz unbiografisch in den Hintergrund gedrängt wird.
Schuh sei Dank bleiben uns so die peinlichen Konfessionen erspart! Zur Befriedigung der großen Neugier gibt der Essayist als Bonus Anekdoten aus seiner Kindheit und Jugend zum Besten, die allerdings nie der medialen Lust nach Selbstentblößung entspringen. In dieser Zurückhaltung liegt wohl auch ein wenig Bescheidenheit, denn nichts scheint Schuh weniger interessant als seine Befindlichkeiten – ein Umstand, der eine Empfehlung seinerseits nach sich zieht: Lesen Sie lieber Thomas von Aquin!
Diese freundliche „captatio benevolentiae“ entspricht ganz dem lebenden Understatement Schuh, der vorgeblich so gern Gelehrter und Philosoph geworden wäre und sich nicht einmal als Schriftsteller eindeutig zu klassifizieren wagt. Nur eines ist sicher: Schreiben bedeutet Lust und verhandelt in seinem Fall das ewige Dilemma, „dass man als Mensch zum Glück geboren ist, aber ausgerechnet mit dem Leid zurande kommen muss“.
Nicht oft gelangt Schuh zu derartig prägnanten Synthesen. Viel lieber zieht er sich ins Labyrinth seiner Dialektik zurück und hat seinen Spaß daran, dem Verfolger plötzlich über eine rhetorische Seitengasse zu entkommen. Es scheint also fast, als stellte er die unendliche Suche nach der ‚Wahrheit‘ über den erschriebenen heuristischen Ertrag.
Trotz der Gratwanderung zwischen argumentativer Verspieltheit und dem potenziell unabschließbaren Prozess des Fragens und Antwortens weiß sich die reflexive Brillanz zu behaupten, schafft es die „defekte Wunschmaschine“ Schuh, aus der Vielzahl von Aspekten und Argumenten eine gewissermaßen vorläufig definitive Conclusio zu ziehen.
Zum Stichwort „Politik“ passt etwa die griffige Quintessenz: „Demokratie ist die Herrschaft der Unfähigen über die Desinteressierten.“ Hinsichtlich des Heimatbegriffes gibt er dem eiligen Leser ein schönes rotweißrotes Verdikt an die Hand: „Österreich hat eine sprichwörtliche Differenz, nämlich die zwischen der relativen Hässlichkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse und der absoluten Schönheit des Landes.“ Na also! Wer am tiefgründigen Denker noch den Psychologen vermisst, dem sei folgende Einsicht mitgegeben: „Man fährt oft aus der Haut, weil man aus seiner Haut nicht heraus kann.“
„Ach“, wie leicht ist es dagegen, über das schwierige Geschäft der Essayistik und die Aporie des vermeintlich freien Schriftstellers zu berichten oder kühl über Ohnmacht und Grandezza des Intellektuellen zu befinden!
Ich für meinen Teil lese diese Memoiren jedenfalls als Einübung in die seltene Kunst der Demut, und gerade dieser Aspekt macht sie auch menschlich überaus sympathisch..