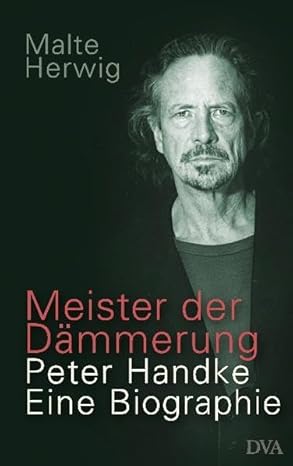Die Biographie selbst ist nicht primär sensationslüstern, sondern in vielem sorgfältig recherchiert und getragen von einem großen Respekt vor dem Autor und seinem Werk, beide versucht der Band vor allem oder beinahe ausschließlich aus den schwierigen Anfängen dieses Schriftstellerlebens zu erklären. Das zeigt sich auch in der Gewichtung: Gut zwei Drittel des Buches nehmen Kindheit, Jugend und literarischer Werdegang bis zur Rückkehr nach Österreich im Jahr 1979 ein, dann wird die Darstellung deutlich kursorischer, die großen Romane der 1990er Jahre haben den Biographen kaum mehr interessiert.
Wie sehr das Augenmerk auf Kindheit und Herkunft gerade im Fall Peter Handkes berechtigt ist, war in Hans Höllers Monographie (2007) nachzulesen, und zwar deutlich stringenter, vor allem was die familiären Konstellationen und ihre literarischen Verarbeitungen betrifft. Höller hat als erster darauf hingewiesen, dass Handke die Gestalten seiner mütterlichen Familie vom ersten Roman an „näher an sich heranrückte, eine Generation übersprang“, den Großvater in den Vater und den Onkel Gregor in seinen Bruder verwandelte. Trotzdem liest Herwig vor allem Handkes frühe Werke völlig ungebrochen als autobiographische Selbstaussagen; er ignoriert zunächst den Unterschied zwischen Figurenrede, literarischer Verarbeitung und realen Vorlagen, um diese problematische Lesart dann durch Befragung von Zeitzeugen mit großer Geste zu widerlegen. „Wunschloses Unglück“ schildert das Leben von Handkes Mutter im Kontext ihrer Kärntner Keuschlerherkunft mit slowenischen Wurzeln und den Lebensverwicklungen durch die Zeitgeschichte, doch daraus entsteht nicht primär eine Biographie der Mutter, sondern eine literarische Analyse der strukturellen Gewalt, die das Leben der Benachteiligten immer prägt und dabei so schwer namhaft zu machen ist. Dass dieses Buch eine posthume Hommage an die Mutter war, ist der bittere Beigeschmack dieses Erfolgs, den Handke immer wieder thematisiert hat: „Mit dem Sterben der Mutter fing für den Sohn das Leben an, das lebendige Leben“, notiert er Jahre später in einem seiner Journalbände. Auch „Der kurze Brief zum langen Abschied“ liest Herwig als reine Selbstbeobachtung des Autors, „in eine literarische, aber nicht eigentlich fiktionale Form“ gebracht. Dem Missverständnis, zwischen Leben und Literatur nicht unterscheiden zu können, unterliegen auch Menschen an der Seite des Autors: Marie Colbin muss in Herwigs Buch „seufzen“: „ich komme ja ständig vor in diesen Büchern“. Aber das tut sie eben nicht, oder nicht so, wie sie es vielleicht gerne gehabt hätte. Am Ende, so schränkt selbst der Biograph einmal ein, gehören die Figuren „doch alle ihm, dem großen Puppenspieler, der in jedes seiner Geschöpfe etwas von sich selbst gibt und ihnen so sein diaphanes Wasserzeichen aufdrückt. Der Musen Lohn ist reich und karg zugleich.“ (244) Das sind die sprachlichen Ausrutscher, die sich in den ansonsten eher journalistisch kargen, aber durchaus flotten Stil des Buches mitunter einschleichen.
Herwig konnte umfangreiche private Korrespondenzen einsehen und er bringt vor allem ausführliche Zitate aus den Briefen des pubertierenden Peter Handke an seinen leiblichen Vater, von dessen Existenz er gerade erfahren hat. Das war zweifellos eine existenzielle Ausnahmesituation in einer auch ohne derartige familiäre Verwicklungen schon problematischen Lebensphase, und Handke legt in diese Epistel verständlicherweise vieles an Emotion und Ungestüm hinein. Als Interpretationshintergrund für ein ganzes Autorenleben ist das wohl nur von beschränkter Aussagekraft. Überhaupt scheint das Bild des „Dorfbuben aus Griffen“ eine zu rudimentäre Folie für die Interpretation seines Werkes. Handke geht es keineswegs nur um eine individuelle Befragung und Positionierung, sondern um prinzipiellere Dimensionen, sein Werk verdankt sich einer intellektuellen Verarbeitung der jeweiligen mentalen und gesellschaftlichen Epochenprägungen, die er oft antizyklisch unterläuft. Als das Wort Urbanität im Feuilleton auftauchte, die Alternativbewegung um Zugang im öffentlichen Stadtraum kämpfte und alle erwartungsfroh auf die Metropolen starrten, empfiehlt er, „Über die Dörfer“ zu gehen und tut es. Das Stück ist utopisch, spielerisch, (selbst)ironisch, überhöht, voll Pathetik – mit eingebauten Abstürzen. Doch das Dramatische Gedicht war einfach ein Genre, an dessen Neubesichtigung um 1980 kein Bedarf bestand. Handkes Projekt aber war und ist die Auseinandersetzung mit der Tradition; er studiert ihre Formen und Modelle und adaptiert sie auf seine spezifische Weise, die stets der inneren Logik des jeweiligen Bezugsrasters folgt. Dadurch ist er stets der Manier entgangen und war der erste, der vom radikal „dekonstruierenden“ Experiment zurückfand zu anderen Möglichkeiten von Demontage und Neuadaption überlieferter literarischer Formen, sei es das Epos oder das Märchen.
Auch Handkes Vorliebe für Schwellenorte aus dem als Kind erlebten Umzug von Berlin ins Kärntner Dorf zu erklären, greift wohl ordentlich zu kurz. Da sind schon andere Mechanismen mit im Spiel, die ein problemloses sich Beheimaten für Handke so schwierig machen. Dazu gehören auch die Schuldgefühle des Keuschlerkindes, nicht dazuzugehören; endgültig gesetzt ist der Tatbestand mit dem Wechsel ins Internat. Damit beginnt der Aufstieg und das weitere Anwachsen des „Schuldbergs“ (Handke), der Mutter wie den Geschwistern gegenüber und allen Dorfbewohnern – durchaus in globalen Dimensionen gedacht –, denen ein Ausbruch in die Welt der Bildung, Kunst und Phantasie verwehrt bleibt.
„Meine Krankheiten, Mängel usw. werde ich nicht los, aber ich werde ihrer vielleicht Herr, wenn es mir gelingt, sie als Strukturen (meiner Zeit) zu beschreiben“, hieß es schon im Journalband „Am Felsfenster morgens“ und diesem Programm ist durchaus zu glauben, während Handkes mündlichen Selbstaussagen immer zu misstrauen ist, manchmal vermeint man den Autor direkt kichern zu hören. 2003, so hat Handke seinem Biographen erzählt, reiste er zur Premiere seiner Neuübersetzung des „Ödipus in Kolonos“ am Burgtheater nach Wien, doch aus einem plötzlichen, gleichsam Thomas Bernhardschen „Wiener Innenstadt-Ekel“ sei er zu Fuß vom Flughafen an die Donau marschiert. Das ist eine schöne Geschichte, und sie ist ganz offensichtlich schon literarisch überformt, so wie sie sich dann im großen Epos Die Morawische Nacht als Welttreffen der Maultrommelspieler im Wirtshaus beim Friedhof der Namenlosen wiederfindet.
Prägend geblieben ist Handkes Herkunft aus einem Südkärntner Dorf aber für sein Selbstverständnis wie seine Sehgewohnheiten und für die lebenslänglichen Unsicherheitsgefühle, die der rasche Aufstieg von ganz unten zu enormer Popularität auslöste. Doch dass Handke seine Herkunft nie verleugnet hat, hat ihn immer auch geerdet. Wer sich beim Anblick einer leeren „NIVEA-Dose“ erinnert, „daß derartiges einst fast ein Kleinod war“, der übersieht nicht so leicht, daß vieles, das ihm erstrebenswert vorkommt, auch an ökonomischen Gegebenheiten scheitern kann, und formuliert diesbezüglich Urteile stets vorsichtig: „Der mit einem Garten leben könnte, und ohne Garten lebt, […] begeht ein großes Unrecht“, heißt es in der „Geschichte des Bleistifts“.
„Die Niemandsbucht ist ein Schlüsselwerk, in dem vieles versteckt und manches offenbart wird – ein tückisches Terrain für Biographen“ (272), schreibt Herwig einmal, aber diese Tücken hat er als Biograph oft nicht umschifft. Trotzdem ist es für Handke-Kenner ein lesbares und informatives, wenn auch mitunter ein wenig langatmiges Buch geworden, in dem, vielleicht wegen des vorgezogenen Erscheinungstermins, auch eine Reihe unnötiger Wiederholungen stehen geblieben sind. Die stringentere und zugleich sorgfältigere Darstellung zu Handkes Leben und Werk bleibt aber Hans Höllers Monographie im Rowohlt Verlag.