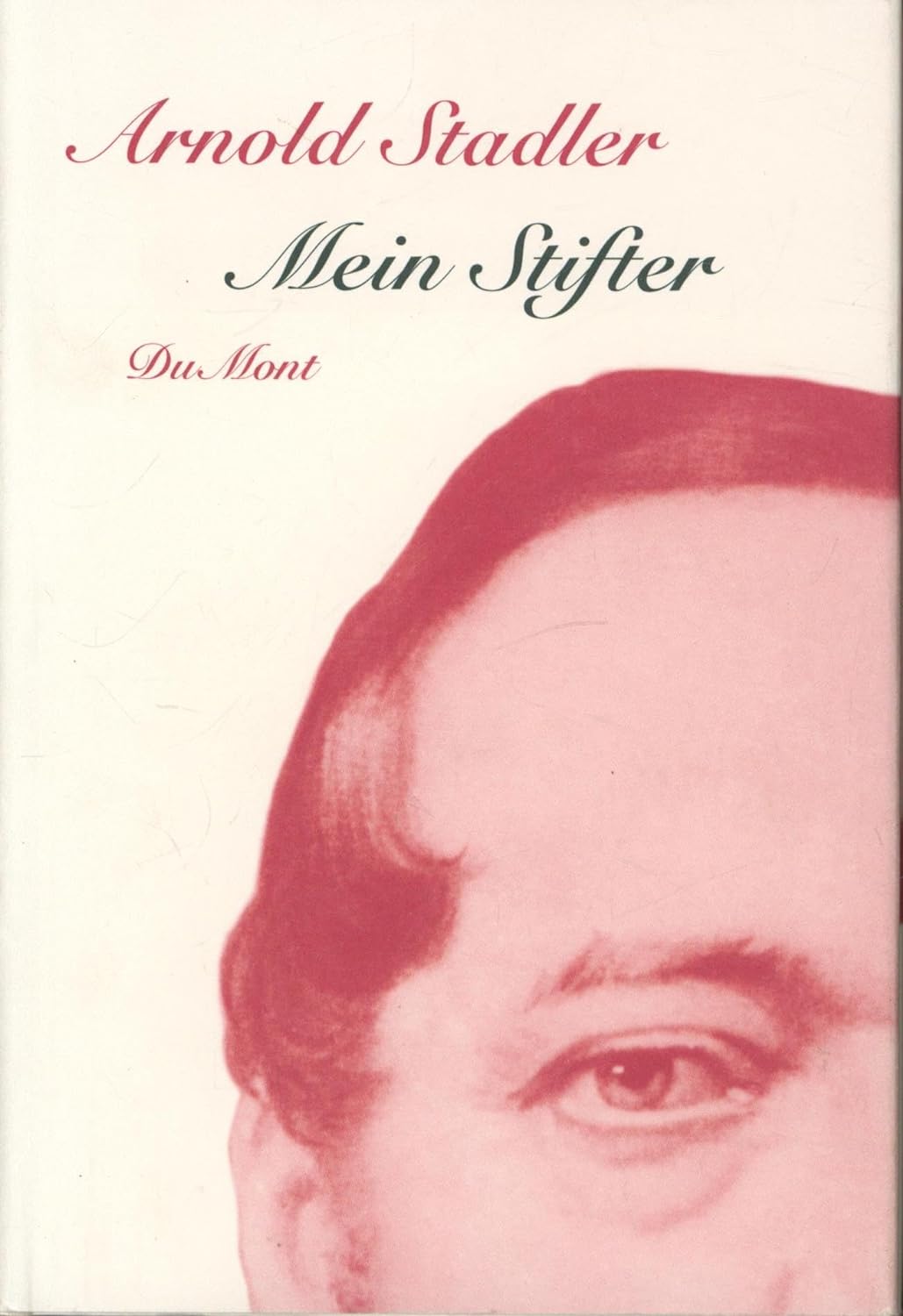Von allen solchen Darstellungen ist die von Arnold Stadler, Büchner-Preis-Träger von 1999, geboren 1954, etwa zwanzig Bücher in zwanzig Jahren, die radikalste. Der Titel Mein Stifter weist schon darauf hin. Stadler ergreift Besitz von einem Autor, mehr noch, er verleibt ihn sich ein. Patrick Barnes spricht in seiner Rezension überspitzt von „hermeneutischem Kannibalismus“ (FAZ vom 28.12.2005). Von Distanz keine Spur. Das heißt aber nicht, dass sich Stadler mit Stifter identifizierte. Er macht ihn nicht schmackhaft, er legt Wert auf die Feststellung, dass „sein“ Autor nicht leicht verdaulich sei. Er beschreibt das Dilemma eines verpfuschten Lebens, das mit Selbstmord endet, den er nicht beschönigt und nicht verleugnet, sondern für erwiesen hält. Stifters Fresssucht wird ebenso extensiv ausgebreitet wie seine unglückliche Ehe, seine gescheiterten Erziehungsversuche an den ihm anvertrauten Kindern, seine finanziellen Kalamitäten. Schon in seinem Roman „Mein Hund, meine Sau, mein Leben“ hatte Stadler bekannt: „Adalbert Stifter, ein Dichter, brachte Licht in mein Leben, ein dunkles Licht … als liege eine sehr weite Finsternis um das Ding herum. Ich hatte einen Selbstmörder als Lebenshilfe, seine Nachsommerwelt als Trost, diesseits und jenseits von Schwackenreute, einer Ortschaft, einfach wie ein Halm wächst.“ Dieses Bekenntnis setzt er als Motto über das neue Buch. Wobei schon deutlich wird, dass er nicht den Selbstmörder als Vorbild, sondern dessen Werk als Lebenshilfe verstanden wissen will.
Er gliedert seine Emphase in drei Abschnitte, die Lebensdarstellung anhand der von Stifter überkommenen Photographien, die Rühmung des „Nachsommers“ und den Vergleich mit Thomas Bernhards „Alte Meister“. Die Stifter-Porträts sind ergiebig. Da gibt es das Brustbild des schmallippigen Schulinspektors, der erhobenen Hauptes an der Kamera vorbeischaut; das Standbild des beleibten Honoratioren aus der gleichen „Session“, der den Zylinder abgelegt hat und den Blick ins Objektiv nicht scheut; etwas später das Brustbild eines argwöhnisch den Photographen beobachtenden Modells; dann das Porträt eines kranken Mannes, der nichts mehr von sich und vom Leben zu erwarten scheint. Als ob es keine Kamera gäbe, schaut er an ihr vorbei. Und schließlich das letzte Bild: Ein alter Mann mit verschränkten Armen und zusammengepressten Knien, der Mund ein krummer Strich, wie auf allen anderen Bildern auch, über die Kamera schaut er hinweg mit dem sogenannten himmelnden Blick, also mit nach oben verdrehten Augen, wie ihn die Ikonographie zu allen Zeiten für himmelwärts orientierte Märtyrer und heiligmäßige Frömmler bereit gehalten hat (Federmairs Begriff der Bigotterie wäre hier anzuwenden).
„Leibhaftiges Warten“ schreibt Stadler zu diesem Bild: „Das letzte Bild zeigt einen Menschen, der am Ende ist, fast panisch, aus der Kinderzeit der Photographie: und zeigt auch gleich einen unglücklichen Menschen, und sonst nichts.“ (S. 21). Ein solcher Zugang zu Stifter anhand seiner Photos ist aufschlussreich und ergiebig. Nur verschenkt Stadler diese Möglichkeiten und beschränkt sich auf den Ausruf: „Mein Stifter!“ (S.13).
Im zweiten Teil geht Stadler auf den „Nachsommer“ ein und vereinnahmt ihn ebenso programmatisch als „Mein Nachsommer“. Es ist für ihn das Buch der Bücher, und er scheut sich nicht, den Roman neben die Bibel zu stellen: „Die beiden Bücher – der Nachsommer und die Bibel – stehen einfach nebeneinander.“ (S.136). Warum? „Das Göttliche erscheint im Nachsommer in Gestalt von Rosen und Menschen, ausschließlich als natürliche Offenbarung. Im ganzen Buch kein Satz, der ausschließlich auf eine übernatürliche, und wäre es christliche Offenbarung zurückgeführt werden könnte. Freilich gilt auch, dass der Nachsommer kein Buch ist, das gegen die göttliche Offenbarung stünde, wie sie etwa in der Bibel nachzulesen ist.“ (Ebd.). Stadlers Religionskritik macht sich am Roman fest: „Der Nachsommer ist autark. Er kommt ohne den Himmel aus. Alles Jenseitige hat höchstens die Qualität eines Schattenreichs: Der Höhepunkt ist hier, im Hiersein.“ (S.137).
Nirgendwo überschneiden sich Stadlers und Federmairs Stifter-Bücher deutlicher als an dieser Stelle. Federmair („Adalbert Stifter und die Freuden der Bigotterie“. Salzburg: Otto Müller, 2005) rückt zurecht: „Jahre später habe ich akzeptiert, dass der Nachsommer keine von einem heiligen Geist herstammende Bibel ist, sondern von einem Autor geschrieben wurde, der mit vielen, sehr realen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte und so unsäglich drein sah wie auf den meisten der überlieferten Porträts: eher ein Fleischhauer oder ein frustrierter Schulmann als ein über den Dingen des Lebens stehender Autor.“ (S. 9). Stadler geht weiter: Der Roman ist ein Gegenbild, die Darstellung des Glücks und der Vollkommenheit von einem unglücklichen und verzweifelten Menschen. Alles, was Stifter in seinem Leben nicht erreichen konnte: ein ausgedehntes Anwesen einschließlich Rosengarten, eine glückliche Ehe, einen zufriedenen Nachsommer zum Lebensausklang – das hat er im Roman dargestellt.
Ein dritter Teil ist dem vorletzten Roman Thomas Bernhards gewidmet, „Alte Meister“. Den 2005 zwanzig Jahre alten Roman rechnet Stadler gegen den zweihundertsten Geburtstag Adalbert Stifters auf. Und lässt kein gutes Haar dran. Bernhards Figur „Reger“ verdammt Stifter und wird dafür von Stadler, der Reger mit Bernhard identifiziert, gerügt. „Thomas Bernhard ist ein riesiges Abrechnungs-Programm, ein Word[!]-Abrechnungs-Programm.“ (S. 177) Er sieht nicht ein, dass das einen Sinn hat, weder für den Autor noch für Leser: „Nicht nur zu fragen: Was war das für ein Mensch, sondern auch: Was sind das für Menschen, die sich an so etwas freuen können?“ (S. 176).
Positiv hat Stifter die Welt dargestellt, eine zweite, bessere Welt entworfen. Negativ dagegen sieht Bernhards literarisches Weltbild aus. Stadler kommentiert missbilligend: „Daher der hohe Grad der Zustimmung bei den gegen die Welt (das sind die anderen, die Verantwortlichen, die Schuldigen) grollenden Lesern Thomas Bernhards, welcher eine Lieblingsikone der Haß- und Zynikerfraktion gegen die Welt ist.“ (S. 179).
Ohne Zweifel ist Stadlers „Mein Stifter“ ein aufrichtiges Bekenntnis. Aber es ist auch das Gegenbeispiel eines literarischen Essays. Stadler bekennt sich dazu, dass er bedenkenlos die Trennung von Autor, Erzähler, erzählter Figur, die die Literaturwissenschaft in mühevollem, jahrzehntelangem Bemühen vollzogen hat, aufhebt. Autoren und Figuren werden gleichgesetzt: „Wie also der alte Risach in seinem Rosenhof, so sitzt Thomas Bernhard in seinem Vierkanthof, nur unglücklicher als Risach, und darin verwandt seinem Erfinder Adalbert Stifter. Der eine denkt nach. Der andere rechnet ab. Beide kaufen dazu, bis zuletzt. Beide bauen unentwegt und haben sich doch, wie sie behaupten, von der Welt zurückgezogen.“ (S. 164f.).
Lassen sich realer Autor und fiktive Figur, Figur und anderer Autor so leicht miteinander identifizieren, als wären sie gleichermaßen real? Zweifel sind angebracht. Stadler will diese Unterscheidungen nicht gelten lassen (S.163). Er zwingt zusammen, was nicht zusammengehört. Das könnte der Leser erfrischend unkonventionell und anregend originell empfinden, wenn nicht ein Ärgernis dagegen stünde: der schlampige Stil, die unentwegten Wiederholungen. Sie sind nicht entschuldbar. Gebetsmühlenartig werden die Thesen, ohne dass sie ausreichend begründet würden, repetiert. Statt in Trance zu versetzen oder einen Sog zu erzeugen, gehen sie auf die Nerven. Wenn Stadler sie vermieden hätte, hätte er Platz gehabt, auch andere Werke Stifters zu behandeln. So aber begnügt er sich mit der stereotyp fadenscheinigen Ausrede: „es ist mir auf diesem beschränkten Raum nicht möglich, den ganzen Stifter zu vergegenwärtigen“ (S. 11).
Trashmäßige Formulierungen finden immer wieder in Stadlers Büchern ihren Platz. Auch hier macht er nicht halt vor Wortbildungen wie „what shall’s?“. Oder: Er klärt die Frage, wann Marlene Dietrich geboren sei: 1806! („Stifter hatte versucht, sein Geburtsdatum auf das Jahr 1806 zu verlagern, als wäre er Marlene Dietrich.“ S. 42.) Dagegen fällt eine falsche Namensschreibung („Lampertsberg“ statt Lampersberg, S.174) nicht ins Gewicht. Insgesamt: Nicht ergiebig. Federmair lesen!