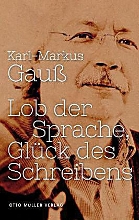In diesem Zusammenhang sei eines vorweggenommen: Der Band Lob der Sprache, Glück des Schreibens ist eine spannende Essaysammlung und ein kleines Lehrbuch über die Welt und ihre großartigen, intoleranten, kleinkarierten und sympathischen Bürgerinnen und Bürger. Ein richtiger Gauß … einhundertsiebzig Seiten lang auf den Reisen zu den randständigen Europäern, kleinen Nationalitäten und sprachlichen Wenigerheiten. Und ein Zweites sei ebenso vorangestellt: Gauß meint in seinem Band, oft sei er sich lesend nicht klar darüber, ob ihm ein Buch gefalle oder nicht. Ich bin mir im Klaren, dass mir Lob der Sprache nicht nur gefällt, sondern mich begeistert, und zwar aus einem herausragenden Grund, den ich mit einem Zitat aus eben diesem Werk begründen möchte: „So vieles wusste dieser Mann! Und so vieles wissen wir von ihm!“ Der Richtigkeit halber müsste auch der erste Satz des Zitats im Präsens stehen. Dieser Autor weiß so vieles.
Die im Buch versammelten Texte stammen aus den letzten zwanzig Jahren und sind verstreut „in großen und kleinen Zeitungen“ veröffentlicht oder als Reden gehalten worden. Manches ist in Anthologien oder Büchern herausgekommen. Gesammelt sind Editorials, Erzählungen, Essays, Glossen und andere Textsorten. Die Themen sind vielfältig und reichen von der Ausländer- über die Kinder- bis zu anderen Feindlichkeiten und die verschiedenen Lieben dazwischen. Damit schreibt Gauß die Geschichte und Geschichten europäischer Städte auf, die bedeutend, aber kaum bekannt sind, beispielsweise Sejny, die wohl kaum einer kennt. Er erweist sich dabei als genauer Beobachter, das allein genügt ihm aber nicht, er schaut aus einem besonderen und nicht gewöhnlichen Blickwinkel … zu. Manchmal ist das Buch sogar eines über die Sorgen Gauß‘, mit denen man eigentlich gut leben kann, so über das umweltbewusste Entsorgen von Jogurtbechern und ihren Deckeln. Daneben macht er sich über den Nobelpreis und seine Träger Sorgen. Er geißelt gleichzeitig die „Zuchtanstalten des Creative Writing“ und die deutschsprachigen Romanschriftsteller, die stilistisch dem Siegeszug amerikanischer Romane folgen – dabei fragt man sich unwillkürlich, welchen österreichischen Kollegen seiner Generation er wohl meinen könnte … Einige Nachrufe auf Berufsgenossen, so Gerhard Amanshauser oder Eörsi István, hingegen sind berührend.
Wir erfahren, dass Gauß besonders die Tagebücherlektüre schätzt. Aber wer würde Kafka und Schnitzler, in welchem Genre auch immer, nicht bewundern. Oder ein Diarium mit dem wunderbaren Titel Tagebuch bei Nacht geschrieben von Gustaw Herling. Apropos Tag und Nacht: Ein Thema lässt Gauß selbstredend nicht aus, die Sexualität, den Sex, den periodischen Geschlechtsverkehr und seine Varianten, das Bruttolustprodukt, ohne auf die Nachspiele zu vergessen. Er schreibt (folgerichtig) über das Erröten und die Peinlichkeit, über Toleranz und Salzburg. Der eine und andere Seitenhieb gilt in fast zärtlicher Salzburger Verbundenheit Thomas Bernhard.
Karl-Markus Gauß beschäftigt sich noch mit einem weiteren wichtigen Salzburger, und zwar Herbert von Karajan, wobei ich aus meinem besonderen Blick(e)winkel eine Information – naturgemäß ohne Lamento – vermisse, nämlich die slowenische Mutter des Jahrhundertdirigenten. Vielleicht schreibt Gauß einmal einen Aufsatz über sie.
An diesem Buch stört, auch das sei erwähnt, nur eines: seine altväterische Aufmachung inklusive dem nicht geglückten Schriftbild der Überschriften, weil die Texte sehr heutig sind.