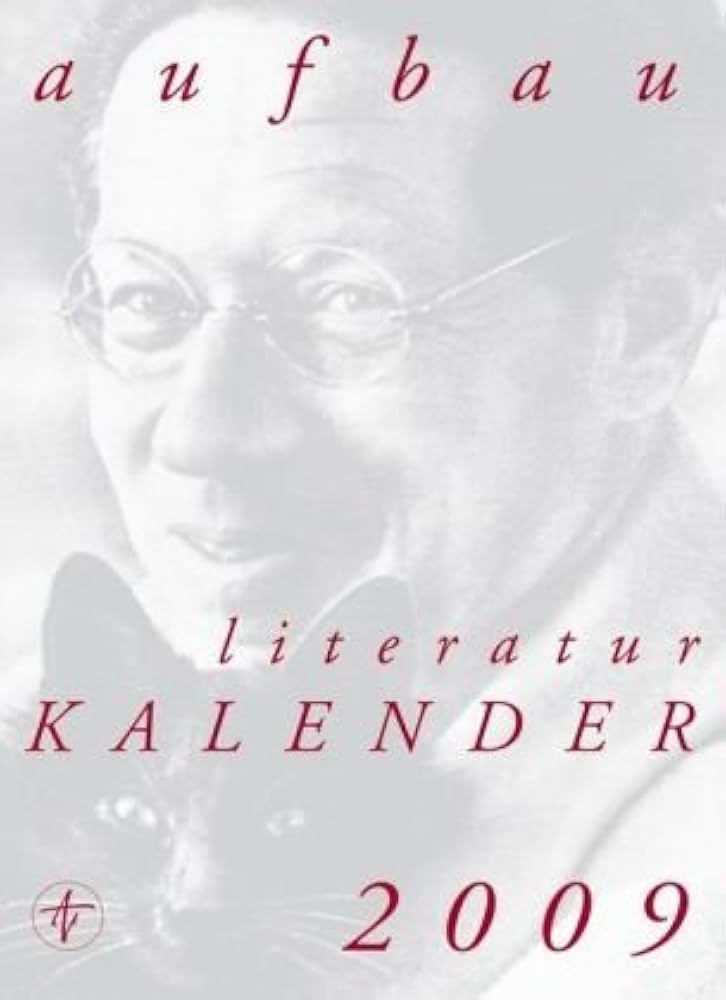„Der Aufbau Literaturkalender ist eine Institution. 2009 im 42. Jahrgang, spannt er einen Bogen von den Klassikern bis zur Gegenwart, von Weltbürgern bis zu Heimatdichtern, von der kleinen Form bis zum Familienepos. Woche für Woche klug, überraschend und ansprechend gestaltet, bietet der dienstälteste Literaturkalender Deutschlands in Texten, Bildern und Notizen 53 Gelegenheiten, Literatur zu entdecken und zu genießen.“
Viel versprechend liest sich der „Klappentext“, mit dem das jüngst in Turbulenzen geratene Verlagshaus die aktuelle Ausgabe seines literarischen Jahresbegleiters anpreist. Bei genauerer Betrachtung erweisen sich die 53 Wochenblätter als von höchst unterschiedlicher Qualität, nicht zuletzt was die Präsentation der SchrifstellerInnen betrifft: Vorgestellt werden 41 Autoren (Friedrich Schiller darf anlässlich seines 250. Geburtstages zwei Mal auftreten) und acht Autorinnen aus drei Kontinenten – sechs davon aus Österreich – ein literarisches Werk (Peter Weiss‘ „Ästhetik des Widerstands“), eines der berühmtesten Meisterwerke der Buchmalerei („Les très riches Heures du Duc de Berry“ / Das Stundenbuch des Herzogs von Berry aus dem 15. Jahrhundert) und ein dem Hauptgott der Inka-Religion, Viraquocha (die weitaus häufiger zu findendende Schreibweise lautet übrigens Viracocha) gewidmetes Gebet.
Die Texte – Zitate aus Reden, Briefen, Gedichten, Erzählungen oder Romanen – stammen nicht immer von den Schreibenden selbst, es werden auch Einschätzungen von Zeitgenossen oder nachgeborenen Kollegen sowie namentlich nicht gezeichnete Texte verwendet. Ergänzt werden diese durch Fotos, Gemälde und Grafiken. An jedem Tag des Jahres – die Monate werden ausschließlich in Zahlen angegeben – sind Geburts- und Todestage bekannter AutorInnen angeführt. Oft finden sich auf den grafisch wenig einfallsreich gestalteten Seiten – die grafische Linie wird ungeachtet unterschiedlicher Bildmotive und Textlängen durchgezogen – sehr knappe biografische Angaben, oft aber fehlen sie auch. Dasselbe gilt auch für Quellenangaben zu Texten und Abbildungen, die entweder nicht vorhanden oder so marginal sind, dass man größte Mühe hätte, manche Texte oder Bilder zu finden.
Diese Inkonsequenz und die daraus resultierende schwankende Qualität ist auch das große Manko dieses „dienstältesten Literaturkalenders Deutschlands“; es ist schade, dass eine so aufwändige und sicher auch kostspielige Unternehmung in mancher Hinsicht mit so wenig Sorgfalt, oft geradezu lieblos, ausgeführt wurde.
Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die Auswahl der Autoren und Texte oft vom Zufall oder möglicherweise von der leichten Erreichbarkeit oder Greifbarkeit bestimmt wurde.
Es ist einfach ärgerlich, wenn die Hälfte der wenigen präsentierten Autorinnen nicht mit eigenen Texten vorgestellt wird; bei Bettina von Arnim geschieht das durch einen wenig aussagekräftigen Brief ihres Bruders Clemens Brentano, bei Astrid Lindgren ist es Margareta Strömstedt. Dass die schwedische Journalistin mit Lindgren befreundet war, selbst Kinderbuchautorin ist und eine Biografie über die Kollegin geschrieben hat, darf man selbst herausfinden, denn im Kalender erfährt man das leider nicht. Bei Marlen Haushofer wird ein deutscher Journalist zitiert und Sarah Kane, eine der bedeutendsten Dramatikerinnen der 90er Jahre, wird mit uninspirierten, namentlich nicht gezeichneten Sätzen wie folgenden vorgestellt: „Über Nacht wurde die junge Engländerin als Greueldramatikerin skandalisiert, die auf der Bühne vor keiner Grausamkeit zurückschreckte. Ihre Stücke machten sie als Wortführerin der neuen wilden britischen Extremdramatik auch an deutschen Bühnen bekannt und berüchtigt.“
Blätter wie diese schüren die Vermutung, dass die Redakteure ihr Interesse sehr ungleich verteilt haben oder es ihnen bei manchen AutorInnen im Laufe der Recherche verloren ging. So fehlen bei dem italienischen Renaissancedichter Pietro Aretino nicht nur biografische Angaben, das abgedruckte Textzitat – wieder ohne Namen – stammt nicht nur nicht von Aretino, es enthält auch Gemeinplätze wie „sinnenfroher Dichter“. Auch Stilblüten wie jene auf dem Blatt mit Franz Fühmann – „1984 starb er als einer der nachdenklichsten ostdeutschen Schriftsteller in Berlin“ – hätte ein aufmerksameres Lektorat wohl verhindert.
Dass die Redakteure aber auch anders können, zeigt etwa das Kalenderblatt zu dem französischen Autor rumänischer Herkunft Panaït Istrati (1884-1935). In einer Kurzbiografie erfährt man wesentliche Eckpunkte aus dem kurzen, abenteuerlichen Leben des Sohnes einer rumänischen Wäscherin und eines griechischen Schmugglers (in manchen Quellen ist er Seefahrer), den sein Mentor Romain Rolland ob seines erzählerischen Talents „Gorki des Balkan“ nannte. Das angeführte Textzitat stammt aus Istratis berühmtesten Buch „Vers l’autre flamme“ (1929). Der 1930 auf Deutsch unter dem Titel „Auf falscher Bahn“ erschienene politische Reisebericht ist eine Abrechnung des einst glühenden Kommunisten mit der stalinistischen Diktatur, die Istrati nach einer 16-monatigen Reise durch das Mutterland des Kommunismus schrieb. [Seine früheren kommunistischen Freunde brandmarkten ihn daraufhin als „Faschisten“, und Istrati kehrte krank und gebrochen nach Rumänien zurück, wo er 1935 an Tuberkulose starb.]
Sätze wie der folgende machen Lust darauf, mehr von diesem Autor zu lesen und über ihn zu erfahren, und das könnte oder sollte doch wohl auch ein Ziel eines Literaturkalenders sein:
Ich will nicht mehr hören, was die Menschen sagen, nur betrachten, was sie tun: Zeigt mir, was ihr von eurem Leben opfern könnt, und ich werde euch sagen, wie hoch ihr das Leben der Andern einschätzt.