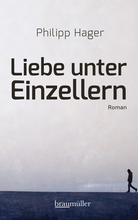„Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Vielleicht gab es doch einen Weg aus diesem zerklüfteten Krater, irgendwohin, wo klares Wasser rann und nicht jeder Schritt über spitze Steine führte. Vielleicht wartete irgendwo in der Zukunft ein Leben, das heil sein würde, das nicht nur aus Mauern und Albträumen bestand“ (42), sinniert der junge Ich-Erzähler. Sein Leben führte bereits über einige „spitze Steine“: Auf einen Ausbruch der Mutter mit ihren Kindern aus der Provinz nach Wien folgte aufgrund einer Erkrankung rasch die Rückkehr. Die Beschreibung dieses Aufenthalts in Wien stellt die schmale Rahmenhandlung des Romans dar. Knapp beschreibt die Ich-Figur ihre Kindheit, detailliert werden die Schilderungen erst ab dem Zeitpunkt als Maria, die Liebe auf den ersten Blick, auftritt: „Mir wurde klar, dass ich schon Wochen und Monate auf der Suche gewesen war, nach irgendetwas, das mich aus meinem Leben herausholt.“ (14)
Der Protagonist versucht ab diesem Moment seine Freundin zu beschützen, ihr Vater wurde wegen Drogenhandels verurteilt und brachte sie schon früh mit illegalen Substanzen in Berührung. Das junge Paar schottet sich weitgehend ab, bleibt Schule und Universität fern und baut sich einen geschützten Raum aus Zuneigung, Gesprächen und Suchtgift. Dem Autor gelingt es die unterschiedlichen Facetten einer jungen Liebesbeziehung darzustellen, auf Euphorie und bedingungslose Liebe folgt unweigerlich einseitige Unruhe. Die feinen Momente des Übergangs fängt der Autor bravourös ein. Als die Jugendlichen auf Anraten der erwachsenen Bezugspersonen in die Kriminalität abdriften, gerät ihre vermeintlich heile Welt zunehmend ins Wanken. Denn diese Aktivitäten sorgen nicht nur für Autonomie und Aufregung, sondern sie vergrößern die Risse am feingesponnen Kokon. Als der selbstbezogene Musiker Julian auftaucht, wird es noch komplizierter.
Der Held verachtet die angepasste Strebsamkeit der Menschen, die wie auf Schienen durch die Stadt und ihren Alltag gleiten. Er versucht seinen eigenen Weg fern der gesellschaftlichen Normen einzuschlagen, ein Motiv, das auch schon in früheren literarischen Veröffentlichungen Philipp Hagers, wie „Das Spektrum des Grashalms“ (2008), „Im Bauch des stählernen Wals“ (2013) und „Wieso riechts hier nach Benzin und was macht das Streichholz in deiner Hand“ (2014) seine Entsprechung findet.
In Liebe unter Einzellern wird ein Portrait eines anderen Wien, fern von höchster Lebensqualität und individueller Optimierung skizziert. Der Roman führt seine Leserinnen und Leser durch U-Bahnstationen, Bahnhöfe und Wohnbausiedlungen. In die guten, schön renovierten Gegenden kommt der Erzähler „zum Arbeiten“, beispielsweise am Weihnachtsmarkt. Die verwinkelten Gebäude und hohen Gemäuer erwecken Unsicherheit: „Wenn meine Augen über den krummen Stein wanderten, war er bis zur Unkenntlichkeit überwuchert mit jenen Albträumen, die ich in diese Stadt hineingetragen hatte, die hier in grauen, feuchten Nebel explodiert waren und alles überzogen hatten wie Schimmel.“ (63)
Philipp Hager führt seinen Leserinnen und Lesern in Liebe unter Einzellern die Sicherheit eingespielter Paarbeziehungen vor Augen und zeigt zugleich deren Grenzen auf. Hagers Stil variiert in seinem aktuellen Roman zwischen prägnanten Dialogen und detailverliebten Beschreibungen, wobei letztere überwiegen. Die gezogenen Vergleiche variieren ebenfalls, teilweise präzise gesetzt, teilweise überraschend simpel: „Bis dahin hatte sie keine Hoffnung gehabt, dass sich alles noch einmal zum Guten wenden könnte, aber an diesem Tag, nachdem sie ihren Vater so erneuert gesehen hatte, blühte die Hoffnung in ihr auf wie eine Weinrebe.“ (41)