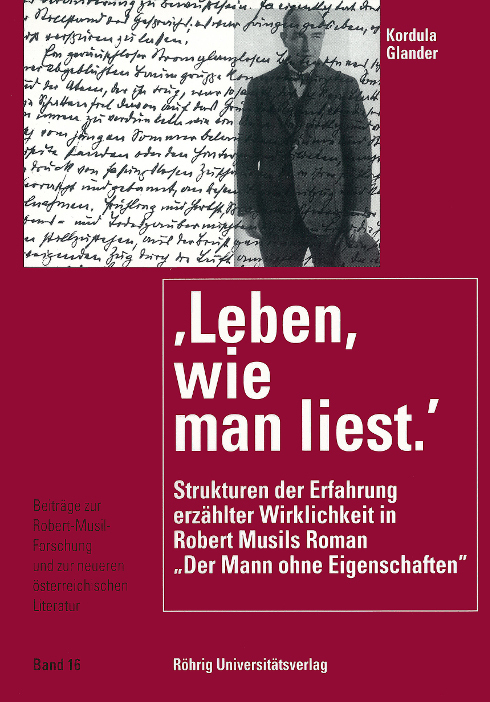Die Robert-Musil-Studien des Röhrig Verlages, herausgegeben von der Arbeitsstelle für österreichische Literatur und Kultur der Universität des Saarlandes ist eine solche Reihe, deren Forschungen ein Forum bietet, ein Werk und dessen Kontext auszuloten, und – es gibt wohl wenig Autoren, die sich dafür in so ausgezeichneter Weise eigneten wie Robert Musil. Sein lebenslanges Schreiben an – wenn man so will – einem Buch, macht sein Werk für die Fragen nach Text und Zeitgeschichte besonders fruchtbar. So sind in den letzten Jahren Untersuchungen entstanden mit Titeln wie „Ulrich und Agathe“, „Identitätskrise als Beziehungskonflikt“, „Der Philosoph als Dichter“, „Muße und Müßiggang im ‚Mann ohne Eigenschaften'“ oder zur Entwicklung der fünf Fassungen der „Versuchung der stillen Veronika“.
Eines der wichtigsten Probleme moderner Literatur stand noch aus: das des Grenzverlaufs zwischen Fiktion und Realität. Ihm ist nun Kordula Glander mit ihren Überlegungen zu den Strukturen der Erfahrung erzählter Wirklichkeit im „Mann ohne Eigenschaften“ nachgegangen. Programmatisch dafür nicht nur der Titel der Arbeit, „Leben, wie man liest“, sondern auch das Motto ihrer Einleitung: „es kommt auf die Struktur einer Dichtung heute mehr an als auf ihren Gang. Man muß die Seite wieder verstehen lernen, dann wird man Bücher haben“. Beides sind Zitate aus Musils „Mann ohne Eigenschaften“ und damit Teil der vielen Selbstkommentare des Autors, die sich nicht nur außerhalb des Romans finden, sondern seine Anlage wesentlich mitbestimmen. Wie sehr der Autor dem Wie den Vorrang über das Was gab, belegen vor allem die Materialien des Nachlasses, die durch die zahlreichen Entwürfe, Varianten und Überarbeitungen die akribische Arbeitsweise eines Schriftstellers zeigen, der sich poetisch und ästhetisch ganz auf das Wie konzentrierte. Bereits vollständig konzipierte Seiten werden immer wieder erprobt, umgeschrieben und variiert. Ganz besonders die zentralen Passagen sind von vornherein zweispaltig (was auch heißt: zwiespältig) angelegt. Und nicht nur das: Die Formel, „Leben, wie man liest“, offenbart sich zugleich als existentielles Programm, die Grenzen zwischen Leben und fiktiver Wirklichkeit erkenntnistheoretisch in Frage zu stellen und diese Frage in den Roman zu inkorporieren. Nach Kordula Glander betreiben die Figuren des „Mann ohne Eigenschaften“ und ihr Erzähler „ihre eigene Vertextung“, Nahtstellen der Fiktion – Zeit, Raum, Geschehen – sind dichotomisch. Zuletzt erfährt, als Folge davon, das schreibende Subjekt seine Dezentrierung, es muss auf traditionelle Anschaulichkeitskategorien verzichten und sich ganz auf die Mitarbeit des Lesers verlassen, der in seiner Vorstellung die fiktive Wirklichkeit nicht nur erzeugen, sondern auch als fiktive/virtuelle durchschauen und „lesen“ muss. „Leben, wie man liest“ wird so nicht nur zum Leitthema des Romans, welches den Erzählgestus prägt, es ist auch eine Aufforderung an den Leser, diese Auflösungstendenzen von Wirklichkeit und Fiktion individuell transitorisch nachzuvollziehen. „Was zunächst als bloße Verweigerung alles Erzählerischen erscheinen mag […], motiviert [… ], die eigene Subjektivität bei der Rezeption bewusst einzusetzen und zu reflektieren“.
Bereits auf den ersten Seiten überzeugt die Untersuchung durch einen klaren Abriss ihres Vorhabens, durch Genauigkeit der Argumentation, durch wohlüberlegte Begrifflichkeit, die sich nicht im wissenschaftlichen Jargon verliert, leserfreundlich bleibt und trotzdem in jedem Satz auf Erkenntnisfortschritt zielt. In den folgenden Kapiteln zur erzählten Wirklichkeit, zu den erzählerischenGelenkstellen der Zeit, des Raumes und des Geschehens werden dann – fußend auf Rezeptionstheorie und Narrativik – durch erste Textanalysen die Auflösungstendenzen und Grenzübertritte anschaulich belegt, so dass, nach der Bereitlegung der theoretischen und methodischen Basis, im 2. Teil der Arbeit die zentrale Frage nach der Vermittlung erzählter Wirklichkeit angegangen werden kann. Am Ende das Ergebnis: „Je mehr das Erzählte also die objektivierende Ordnung von Außenwelten […] versagt, desto stärker werden Innenräume wahrnehmbar“; zuletzt ist der Leser selbst aufgefordert, immer wieder Zweifel an der Authentizität sprachlicher Äußerungen zu hegen.
Eine Studie wie diese, die sich den Übergängen, der Verdichtung, den fließenden Wirklichkeitsgrenzen, der Ästhetik des Fragments verschrieben hat, lebt vom Detail. Will man die differenzierten Einzelergebnisse nicht vergröbern, muss man es – bei der Kürze einer Rezension – bei den wenigen Hinweisen auf Inhalt und Anlage belassen. Die ‚wirkliche Wirklichkeit‘ gibt es nicht, das war der Literatur und der Philosophie um die Jahrhundertwende klar geworden. Wie das alles in dem – notwendigerweise – Fragment gebliebenen Musilschen Roman auch ästhetisch eingelöst werden konnte, das lässt diese Studie Glanders auf erkenntnisreiche und spannende Weise nachvollziehen. Sie, als Wissenschaftlerin, ging dabei nicht nur mit der nötigen professionellen Akribie vor, sondern vollzog, spielerisch und affiziert von der Lektüre, die Schwebezustände des Fiktiven selber nach, und dedizierte – als kleine Denksportaufgabe für ihre Leser – die Untersuchung „Meiner Mutter und Ulrich“.