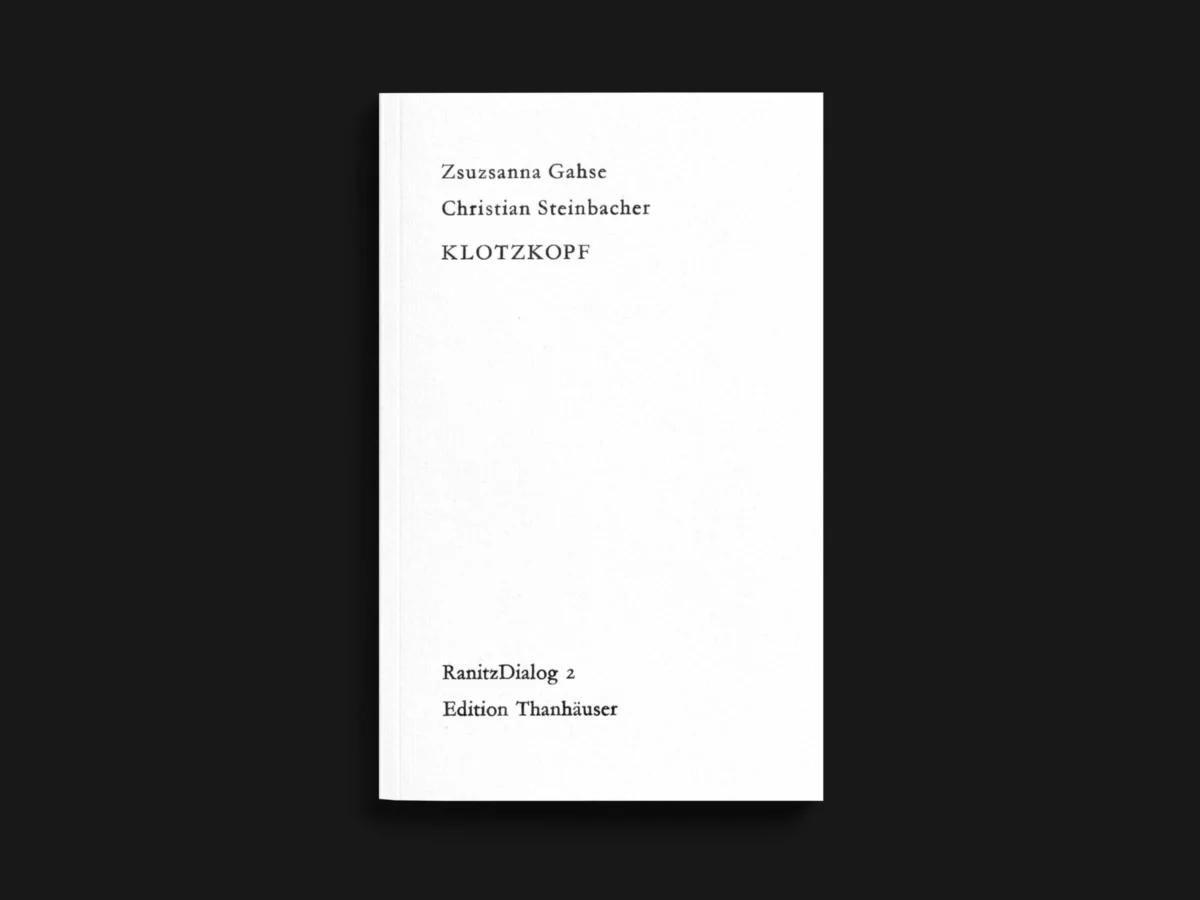Die RanitzDialoge in der Edition Thanhäuser verstehen sich als Plattform zum (bisweilen interkulturellen) Dialog zweier AutorInnen, bieten also immer zweien gleichzeitig eine Bühne, auf der gemeinsam das literarische Feld beackert, die poetische Kooperation ausgestellt werden kann. Diese zweite Ausgabe der RanitzDialoge bestreiten nun die in Budapest geborene Zsuzsanna Gahse und Christian Steinbacher, seines Zeichens Literat, umtriebiger Kulturbetreiber (zuletzt: das Festival „Für die Beweglichkeit“ in Kooperation mit Linz09) und kürzlich Gewinner des Wartholzer Literaturpreises. Ihr „gemeinsames Textgeflecht“, gibt der Verlag Auskunft, „kreuzt um einige vorab gewählte Motivkerne“, unter anderem die Komplexe der Herkunft und der Fiktion, aber auch ganz Konkretes wie Knopf, Pumpe oder Mieder. Letzteres, das Mieder, spielt gleich auf mehreren Ebenen eine tragende Rolle, es ist Inhalt und formgebendes Prinzip in einem: So ist den Verschnürungen des Mieders die alternierende Abfolge der „Textportionierungen“ der beiden Schreibenden nachgebaut, auch die Fußnoten seien, so die Vorbemerkung, „verschnürt“.
Zsuzsanna Gahses Texte setzen mit dem „Erinnerungsmotor“ des Knopfes ein, der Situationen und Menschen aus der Vergangenheit wachruft; um mehrere gesellige Mahlzeiten scharen sich in stillem, melancholischem Ton die Erinnerungen. Ausgehend von einem Familienmitglied und dessen Freundeskreis zeichnet Gahse die zwischenmenschlichen Verzweigungen schrittweise nach, nicht ohne zwischendurch innezuhalten und die Frage nach dem Sinn des Erinnerns und damit des Erzählens selbst zu stellen. Dem Motivkern der Herkunft wird in sprachlichen Wendungen, biographischen Verwurzelungen und Initialerlebnissen nachgespürt. In den weiten Verzweigungen der Bekanntschafts- und Verwandtschaftsstrukturen taucht auch die Verschnürung des Mieders wieder auf; folgt man diesen, „hat man bald die ganze Welt zusammen“ – zusammengeschnürt, will man ergänzen.
Mit historischem Hintergrund setzt Christian Steinbacher ein, er kramt Anekdoten und Randnotizen zum Mieder und seinen berühmten Trägerinnen hervor. Von da an jedoch taucht derart Konkretes, Greifbares nur noch selten, flüchtig auf. Bald nämlich hält Steinbacher dem Leser herausfordernd sein Programm entgegen: „Erst in einer bestimmten Phase der Entwicklung ist das Kind fähig, über etwas, das es bereits gemalt hat, dann in einem zweiten Schritt drüberzumalen, also etwa einen Tiger und das Gitter davor, und mal sehn, wie weit, wie pubertär da nun du bist.“
Der Text als Befragung des Lesers – in Steinbachers Konzeption entsteht er aus der vielfachen Übermalung, Überarbeitung, dem Auftragen zahlloser Schichten. Dieser Arbeitsprozess hinterlässt Spuren an Textoberfläche und -tiefenstruktur (was in diesem Fall – so sehr sich der Leser da auch verbiegen muss – möglicher Weise dasselbe ist): Ständig sprießen, wuchern neue thematische Triebe hervor, verzweigen sich wieder, um irgendwann wieder an ihre Wurzel zurückzukehren – man merkt: Der floralen Metaphorik kann man sich angesichts Steinbachers Arbeitsweise kaum erwehren.
Organisch bis zur Unübersichtlichkeit gestaltet sich so auch die Rezeption: In wirbelnden Satzkaskaden verflicht Steinbacher Herkunft und Heimkehr anhand kursorisch erwähnter Reisen, kunstgeschichtlicher Genealogien, einheimischer und „fremder“ Flora und Fauna, regionaler sprachlicher Eigenheiten und zahlloser anderer Sujets. Wo hier ein Bild seine Wurzeln hat, lässt sich oft erst beim mehrmaligem Lesen dechiffrieren, dafür entlohnen die kleinen Erleuchtungen zur Genüge: Was zum Beispiel an einer Stelle „gar so flott wegflutscht“, entpuppt sich ein paar Zeilen später als indisches Springkraut, von dem aus man über Nebenbemerkungen zur Literaturgeschichte („Rührmichnichtan, x-mal herbeizitiert, bis zum Ermüden“) direkt auf die Herkunftsfrage im Allgemeinen und botanische Fremdenfeindlichkeit im Speziellen zu sprechen kommen kann. An anderer Stelle springt Steinbacher leichtfüßig vom Steinobst („angelaufene Marille“) über physiognomische Eigenheiten („roter Kopf“) zu allergischen Hautreaktionen; das logische Bindeglied zwischen Fußballspieler und Insekt? Richtig, „Flügelstürmer“.
Die Freude am Lesen entspricht hier der Freude am selbständigen Enträtseln, am Entwirren der Assoziationsketten und -schichten. Geradezu archäologisch kann man bei Steinbacher zu Werke gehen, aber auch zahllose andere Lesarten bietet der Text: Ob man ihn sezierend von vorne bis hinten, die Kapitel quer durcheinander, das Ganze rückwärts Satz für Satz (klingt jedenfalls vielversprechend!) oder einen Abschnitt immer und immer wieder liest, ob man sich der sinnlichen Komponente überlässt oder sich gar an einer Deutung nach alter Schule versucht: Alles ist erlaubt, immer werden die Ergebnisse andere sein. Ein paar Fragezeichen natürlich bleiben, aber das gehört vermutlich dazu. Die Eigenständigkeit bezahlt der Leser mit einer einfachen Gleichung: Er bekommt genau so viel heraus, wie er hinein zu stecken gewillt ist.
Steinbacher schöpft aus dem Vollen, wie er sagt, die Fülle der Sprache ist sein Material. Literarische Querverweise, literaturhistorische Verankerung und dergleichen interessieren ihn kaum; wo er ansetzt, das sind die Knotenpunkte der Syntax und der Semantik. Aus ihnen entwickelt er amüsantesten Sprachwildwucher. Nach dem ersten Schrecken sind seine Texte vor allem eines: Freibriefe zum Ein- und wieder Auftauchen, wie und wo immer man will.
Ein Mieder zu schnüren, zwei scheinbar disparate Enden zusammenzufügen, die – so lautet die Annahme – ohnehin Teile ein und desselben Ganzen sind, das ist der Anspruch dieses RanitzDialogs. In der Fusion zweier so unterschiedlicher Schreibweisen ist ein interessantes Experiment über weite Strecken gelungen. Zwar scheinen manche Motivkerne, wie beispielsweise der der Pumpe, nur halbherzig in den Text integriert, möglicher Weise hätte man auch die inhaltliche und formale Verschränkung der Textportionierungen gewinnbringend weiter treiben können. Die Texte selbst und der Ausbau eines Motivs, des Mieders, zur formgebenden Kraft sind hingegen in höchstem Maße geglückt.