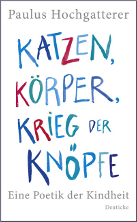Der Autor schildert etwa die Ambivalenz der Geburt, die von allen zu Zeugen gewordenen Erwachsenen als Ereignis in Erinnerung bewahrt bleibt, während der/die neu Geborene ein Leben lang vergeblich eine bewusste Brücke zu seinem/ihrem Eintritt ins Leben sucht. Die Notwendigkeit über Kinder zu schreiben steckt nicht nur, aber eben auch in diesem Mangel an Bewusstsein über die ersten Lebensjahre. Ein Kind ist da, ein Kind spricht, ein Kind erzählt, lauten die ersten drei Stufen von Hochgatterers Poetologie des Kindseins.
Man könnte behaupten, dass die Literatur erst mit seiner vierten poetologischen Grundfigur beginnt: Ein Kind schreit. Im Schrei selbst wird etwas Körperliches deutlich, auch ein Zuhörender nimmt den Schrei eines anderen meist körperlich intensiv wahr. Das Pendant zum Schreien ist das Verstummen, Verstummen als Haltung zur Welt, die letztlich doch keine Spielfläche bietet. Der letzte Akt des Verstummens ist schließlich der Tod. Weiter beschreibt Hochgatterer das Lesen, Zuhören und Spielen als Varianten der aktiven Weltbegegnung. Der Gestus dieser Vorlesungen ist durch Anekdoten und Exkurse aufgelockert und liefert ein stimmiges und anregendes Bild über den „Krieg der Knöpfe“. Das ist im übrigen der Titel eines französischen Films von Yves Robert aus dem Jahr 1962, auf den Hochgatterer wiederholt Bezug nimmt.
Zusätzlich zu den Poetikvorlesungen sind in dem Band Reden und Aufsätze versammelt. Solche Sammlungen sind gerade deshalb wertvoll, weil sie der Flüchtigkeit von Reden oder Vorlesungen das letztlich bescheidene, aber unvermindert wirksame Ewigkeitsgelübde entgegen setzen, das mit der Publikation eines Buches verbunden ist. Einer Kritik muss sich dieser Band jedoch stellen, denn gerade die Wiederholung von Inhalten tut der Sache nichts Gutes. Die zweifelsfrei interessante Interpretation der Metaphorik, die Hochgatterer leistet, findet sich in diesem Buch dreimal in abgewandelter Form. Hier etwas wegzulassen hätte mehr Stringenz und Zugkraft erzeugt. Die Erstfassung beispielsweise von „ursprünglicher Versuch über den Krieg der Knöpfe“ wäre in einer textkritischen Reihe viel besser aufgehoben als in einem Buch, das sich primär an nichtwissenschaftliche Leserinnen und Leser richtet.