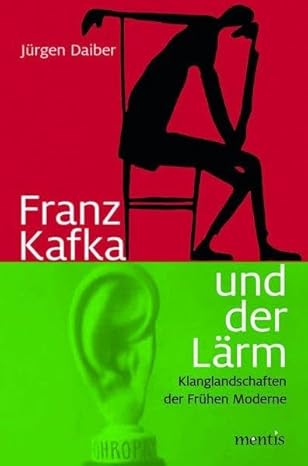Den Auftakt macht die Beschreibung von Kafkas oft analysierter Lärmempfindlichkeit, die ihn in seinen – auch aus Gründen der „Lärmflucht“ (S. 30) – mitunter rasch wechselnden Wohnambientes kontinuierlich quälte. Als „Hauptquartier des Lärms“ bezeichnete Kafka jenes Durchgangszimmer, das er in der elterlichen Wohnung in der damaligen Prager Niklasstrasse 36 bewohnte und das er in der 1912 entstandenen Erzählung „Die Verwandlung“ topografisch genau beschrieb.
Nicht ganz überzeugend integriert sind die drei Exkurse zu Zeitgenossen. Der erste ist Theodor Lessing gewidmet, der sich wie Kafka und viele andere Schreibtischarbeiter damals wie heute vom Lärm der Welt in seiner Konzentration immer wieder gestört fühlte. Lessing gründete 1908 in Hannover einen Antilärmverein und gab die Zeitschrift der „Anti-Rüpel“ heraus, die für Maßnahmen der Lärmvermeidung im individuellen wie sozialen Kontext warb, vor allem aber Klagen über ständig steigende Lärmbelästigungen enthielt. Auch von Prominenz aus der österreichischen Monarchie erhielt Lessing Zuschriften, allerdings nicht von Kafka, sondern von Hugo von Hofmannsthal, zu dem auch Lessings Überzeugung eher passt, dass Geräusche im Alltag zu einem guten Teil kleine Racheakte der dienenden Geister – Teppich klopfen, Peitschen knallen, Hofmannsthal fügt das „unbescheidene Geschwätz der Zimmermädchen“ hinzu (S. 53) – darstellen. Kafka, der von seiner Arbeit bei der Prager Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt her auch die mörderischen Geräuschkulissen in industriellen Produktionshallen kannte, sah das prinzipiell anders. Wenn er auf dem Gut seiner Schwester Ottla in Planá unter den Geräuschen des Holzhackens leidet, ist ihm sein „Luxusproblem“ absolut bewusst: Was der Holzhacker „unbegreiflicherweise den ganzen Tag mit den Armen und dem Gehirn aushält, kann ich mit den Ohren gar nicht aushalten, nicht einmal mit Ohropax“ (S. 29), schreibt Kafka am 30 Juni 1922 an Max Brod. Die Ohropax bezog Kafka seit 1915 vom Apotheker Max Negwer in Berlin-Schöneberg, dem Ahnherrn der Firma Ohropax im hessischen Wehrheim, nördlich von Frankfurt am Main.
Lessings Antilärmverein markiert eine Zeiterfahrung, in der sich die Struktur der städtischen Geräuschkulisse radikal veränderte. Auch wenn Ungleichzeitigkeiten, zumal im vergleichsweise beschaulichen Prag, noch lange für ein Nebeneinander von Auto- und Kutschenverkehr sorgten, ging die Tendenz weg von „natürlichen“, ländlich geprägten Geräuschen – darunter durchaus ambivalente wie krähende Hähne oder bellende Hunde –, hin zum Motorenlärm des neuen Maschinenzeitalters. Wer nicht in die vorstädtischen Industrieviertel vordrang, nahm diese Veränderung vor allem als Revolution des Straßenverkehrs wahr. Anhand von Kafkas Notizen zu seinen beiden Paris-Aufenthalten 1910 und 1911 zeichnet Daiber nach, wie direkt sich die akustische Überforderung Kafkas Körper und auch seinen Sprachbildern einschrieb.
Der Erste Weltkrieg hat die Welt und auch alle Hörsensationen radikal verändert. Diesem Thema ist der längste der Exkurse zu Ernst Jünger gewidmet. Es ist plausibel, dass in Kafkas Erzählung „Der Bau“ (1923/24) das Bild des Schau-Schützengrabens eingegangen ist, wie er in Prag und in den Vergnügungsparks aller Metropolen zu besichtigen war. Die akustische Erfahrung der ausdifferenzierten Geschoßarten, die Jünger beschrieb und Luigi Russolo, dem der dritten Exkurs gewidmet ist, komponierte, ist Kafka erspart geblieben, dank der Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt, die ihn als kriegswichtig reklamierte und so vor dem Fronteinsatz bewahrte. Und in dieser Funktion beschäftigte sich Kafka unmittelbar mit den Folgen der „Melodien des Krieges“ im Trommelfeuer der Stellungskämpfe auf die Gemüter der heimkehrenden Frontsoldaten, die als „Zitterer“ und „Kriegshysteriker“ in Nervenheilanstalten landeten, und für deren Betreuung seit 1915 Arbeiter-Unfall-Versicherungsanstalt zuständig war.
Was Daiber überzeugend gelingt, ist die Darstellung der Bandbreite, mit der Kafka in seinen literarischen Texten wie in seinen Tagebuchaufzeichnungen und Briefen das Phänomen des Lärms in der Welt wie im eigenen Inneren verhandelt. In „Ein Bericht für eine Akademie“ (1917) inszeniert Kafka als zentrales Element der Menschwerdung „die Fähigkeit, Lärm machen zu können und dieses Lärmmachen als angenehm, quasi als natürlichste Sache der Welt zu empfinden“ (S. 76). Gegen Ende seines Lebens entstand eine Reihe von Erzählungen mit stummen Tier-Protagonisten, die wie „Josephine, die Sängerin“ (1924) auch Kafkas Musik-Verständnis verhandeln und zugleich, ähnlich wie der kurze Prosatext „Das Schweigen der Sirenen“, das Verstummen der Kunst.