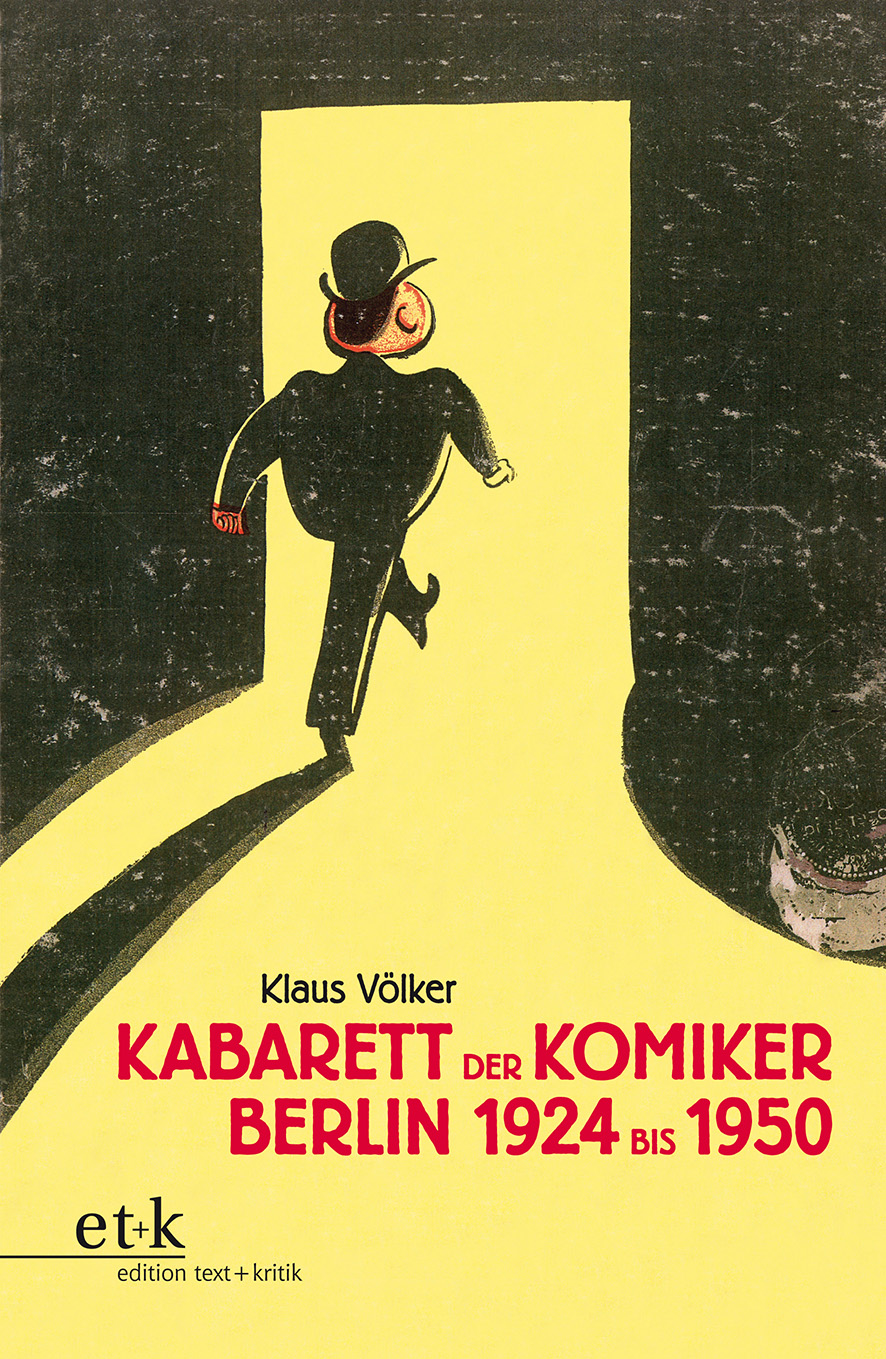Das Kabarett der Komiker („KadeKo“) wurde 1924 gegründet. Die ersten Direktoren waren der aus Prag stammende Kurt Robitschek und der Wiener Paul Morgan. Dieser Schauspieler und Kabarettist ist 1886 geboren und hat in jungen Jahren seinen Geburtsnamen Morgenstern gegen einen zeitgemäßen, amerikanisch klingenden Namen eingetauscht. Morgan und Robitschek hatten einander im Wiener Kabarett „Simpl“ kennen gelernt, sind aber beide in den frühen 1920er Jahren nach Berlin übersiedelt, wo sie sich (nicht zu Unrecht) bessere Arbeitsbedingungen erwarteten. Doch unterhielten sie weiterhin gute Beziehungen zur Donaumetropole, was dazu führte, dass Wiener Künstler (Fritz Grünbaum, Hans Moser u.a.) zu den regelmäßigen Gästen des „KadeKo“ gehörten. Da der „Wiener Schmäh“ im Berlin der 1920er Jahre ausgesprochen beliebt war, ist es den erfolgsorientierten Direktoren nicht schwer gefallen, ihre Wiener Landsleute zu engagieren.
Dennoch darf man sich das „Kabarett der Komiker“ nicht als einen Außenposten österreichischen Humors in Berlin vorstellen. Völker dokumentiert ausführlich, dass hier unterschiedlichsten Künstlern und Künstlerinnen eine Bühne geboten wurde – wer es verstand, das Publikum mitzureißen und zu unterhalten, war willkommen. Karl Valentin und Lisl Karlstadt traten hier ebenso auf wie die Geschwister Ilse und Curt Bois, die als artistische und parodistische Könner brillierten. Der elegante Buffo-Tenor Max Hansen, der in der Uraufführung des „Weißen Rössl“ den Kellner Leopold verkörperte, gehörte zu den Stars des „KadeKo“, desgleichen die Sängerin Claire Waldoff, die einerseits Berliner Heimatschnulzen sang (etwa das Zille-Lied „Sein Milljöh“), andererseits aber als deklarierte „Lesbierin“ (wie man damals sagte) bekannt war und im „KadeKo“ unter anderem mit dem feministischen Chanson „Raus mit dem Männern aus dem Reichstag“ Beifallstürme provozierte.
Völker, der sämtliche Programmhefte des „KadeKo“ ausgewertet hat, zählt eine Unmenge von Akteuren auf, wobei er zuweilen in ein wahlloses Name Dropping verfällt: „Von Ossip Dymow spielte man 1930 den in einem New Yorker Hotel angesiedelten Sketch Der Sprung ins Ungewisse mit Willi Schaeffers als Hotelgast und Paul Morgan als Oberkellner. In einer nochmals überarbeiteten Version wurde er im Februar 1932 unter dem Titel Der Sprung aus dem 35. Stockwerk mit Max Ehrlich als Hotelgast und Harald Paulsen als Oberkellner erneut ins Programm genommen. Mit Max Adalbert als Kassierer Kochalsky inszenierte Robitschek im April 1932 Dymows Groteske Die Bank wird bestohlen! Vera Nargo spielte die Anna Pleschke und Harry Hardt die „schwarze Maske“. Derartige Referate von Besetzungs- und Umbesetzungslisten sind „erschöpfend“ im mehrfachen Sinne des Wortes.
Ungeachtet dieses kleinen Einwandes ist Völkers minutiöse Darstellung aber sehr instruktiv. Sie macht nämlich klar, dass im „KadeKo“ mehr geboten wurde als politische Zeitkritik. Gewiss waren satirische Anmerkungen zum Tagesgeschehen ein fester Bestandteil aller Programme. Ebenso gehörten aber Jazzmusikeinlagen, kurze Komödien und Operetten, aber auch artistische Nummern zu den unerlässlichen Elementen eines gelungenen „KadeKo“-Abends. Alles verband sich zu einer eleganten Revue, die zum einen durch das herausragende Können aller Akteure, zum anderen durch den Witz der Conferenciers (meist Morgan oder Robitschek) zusammengehalten wurde. Das oberste Prinzip des „KadeKo“ hieß nicht „Aufklärung“ oder „Zeitkritik“, sondern „Unterhaltung“. Das Publikum sollte zwar auch ein bisschen zum Mitdenken angeregt werden, vor allem aber sollte es auf künstlerisch hohem Niveau amüsiert werden. Dieses Konzept ging auf, von 1928 an residierte das „KadeKo“ in einem eigenen Haus am Lehniner Platz, das 1000 Zuschauern Raum bot (heute befindet sich an derselben Stelle die „Schaubühne am Lehniner Platz“).
Die glanzvollen Jahre des „KadeKo“, die von 1924 bis 1933 dauerten, sind auch in anderen Publikationen schon beschrieben worden (so von Marie-Theres Arnbom: „War’n Sie schon mal in mich verliebt? Filmstars, Operettenlieblinge und Kabarettgrößen zwischen Wien und Berlin“, Böhlau Verlag Wien, 2006). Deshalb ist Völkers Buch dort besonders interessant und eigenständig, wo er das Weiterleben des „KadeKo“ in der Zeit des Nationalsozialismus beschreibt. Kurt Robitschek, der 1933 durchaus zu weitgehenden Zugeständnissen an die neuen Machthaber bereit gewesen wäre, wurde dennoch im nationalsozialistischen Deutschland nicht geduldet. Die Antisemiten gingen auf Anpassungsversuche jüdischer Künstler nicht ein, Robitschek wurde enteignet und musste Berlin verlassen. Er ging nach Wien zurück, Morgan ebenso. Sie wollten ein Wiener „KadeKo“ installieren, doch scheiterte dieser Versuch an finanziellen und anderen Hindernissen. Robitschek verließ Wien 1934, und baute sich unter dem Namen Ken Robey in New York eine zweite Karriere als Show- und Revueorganisator auf. Paul Morgan blieb in seiner Heimatstadt, wurde nach dem „Anschluss“ verhaftet und starb im Dezember 1938 im Konzentrationslager Buchenwald.
Während die jüdischen Stars des „KadeKo“ vertrieben wurden, machten diejenigen, die vom Rassenwahn der Nationalsozialisten nichts zu fürchten hatten, sozusagen „unverdrossen“ weiter. Zunächst unter der Leitung von Hanns Schindler, nach dessen Tod im Jahr 1938 dann mit Willi Schaeffers als Direktor versuchte das Kabarett, unter den neuen Bedingungen seine Identität als Unterhaltungs-Etablissement zu wahren. Völker beschreibt eindrucksvoll, welcher Verrenkungen und Verbeugungen es dabei bedurfte. Prinzipiell hatten die Nazis – und im Besonderen der geschickte Propagandafachmann Goebbels – nichts gegen Unterhaltung. Selbst ein gewisses Maß an Respektlosigkeit wurde akzeptiert, denn Goebbels wusste sehr wohl, dass man die Menschen nicht mit pathetischen Parolen alleine bei Laune halten kann. Allerdings war die Grenze zwischen einigen erlaubten Hofnarren-Frechheiten und der nicht geduldeten politischen Kritik scharf gezogen. Werner Finck und andere, die das „KadeKo“ nutzten, um sich dem Geist der Herrschenden explizit zu widersetzen, wurden verwarnt, mit KZ bedroht, und einer von ihnen, der Schauspieler Robert Dorsay, der sich weigerte, der NSDAP beizutreten, wurde 1943 zum Tode verurteilt und erschossen.
Dennoch taten Schaeffers und sein Ensemble alles, um selbst unter derartigen Bedingungen den Amüsierbetrieb aufrechtzuerhalten. (Das hing freilich auch damit zusammen, dass beliebte Schauspieler die Chance hatten, vom Kriegsdienst befreit zu werden.) Je länger der Nationalsozialismus dauerte, desto beflissener konzentrierte man sich aufs Unverfänglich-Humorvolle; aus dem „Conferencier“ von einst wurde der „Ansager“, und die Darbietungen ähnelten immer mehr jenen „Bunten Abenden“, die bei der Truppenbetreuung und auf den „Kraft durch Freude“-Reisen für Stimmung sorgten. Völker hält Schaeffers und seinen Leuten allerdings zugute, dass sie immer auf künstlerisches Niveau bedacht waren und dass sie keinerlei Zugeständnisse an den zotigen und brutalen Primitivismus des berüchtigten „Landser“-Humors machten.
1945, nach der Zerschlagung des Terror-Regimes, versuchte Schaeffers, an den Status quo ante anzuknüpfen, und wieder ein „KadeKo“ alten Stils zu etablieren. Aber das Experiment misslang, die Zeit des Kalten Krieges hatte für Komiker, die im Zweifelsfall lieber lustig waren als politisch, endgültig keine Verwendung mehr (das galt im Besonderen in der geteilten Stadt Berlin, die vom Westen wie vom Osten als „Frontstadt“ begriffen wurde.) 1950 schloss das Kabarett der Komiker für immer seine Türen.
Klaus Völkers Darstellung ist ganz auf die Geschichte des „KadeKo“ konzentriert, d.h. der zeitgeschichtliche Kontext wird mehr oder weniger als bekannt vorausgesetzt. Das ist gewiss legitim, da Weimarer Republik und Nationalsozialismus zu den besterforschten Epochen der deutschen Geschichte gehören. Außerdem zeigt sich im Lauf des Buches, dass der Detailblick sehr viel Wissenswertes zu entdecken vermag. So wird es zum Beispiel nicht vielen Leserinnen und Lesern bekannt sein, dass manch ein Star der deutschen Nachkriegsunterhaltung seine Berufslaufbahn im – nicht nazistischen, aber auch nicht ernsthaft widerständigen – „KadeKo“ begonnen hat. Die Liste reicht vom beliebten Radio- und Fernseh-Entertainer Peter Frankenfeld über die Schauspielerinnen Grethe Weiser, Gisela Schlüter und Brigitte Mira oder den Schauspieler Erik Ode (der später zum Urvater aller deutschen TV-Kommissare wurde) bis hin zu Heinz Ehrhardt, dem Lieblingshumoristen der Deutschen. Erhardts Spaßvogel-Karriere begann genau am Abend jenes 1. September 1939, an dem deutsche Truppen in Polen einmarschierten und den Zweiten Weltkrieg auslösten.
Zum Ensemble des „KadeKo“ gehörte in den vierziger Jahren auch Georg Thomalla. Völker zitiert aus den 1988 erschienenen Lebenserinnerungen dieses sehr populären Schauspielers einige selbstkritische Sätze, die sich durchaus als Fazit eignen: „Mit den Mächtigen legen wir uns nicht an – und ich halte es heute für müßig, darüber nachzudenken, ob wir es hätten tun sollen oder nicht. Alle retten sich – wenn eben möglich – zu dieser Zeit in die belanglose Harmlosigkeit.“ Einige Absätze später heißt es dann: „ Narren in schlimmer Zeit sind wir alle gewesen und Hofnarren noch dazu. Die politische Prominenz der Stadt (= Berlin, Anm.) hat die Nähe der Künstler gesucht – und wir Narren haben uns das als Ehre oder Anerkennung der Mächtigen ausgelegt. Ein paar Menschen sind durch diese Beziehungen am Leben geblieben.“