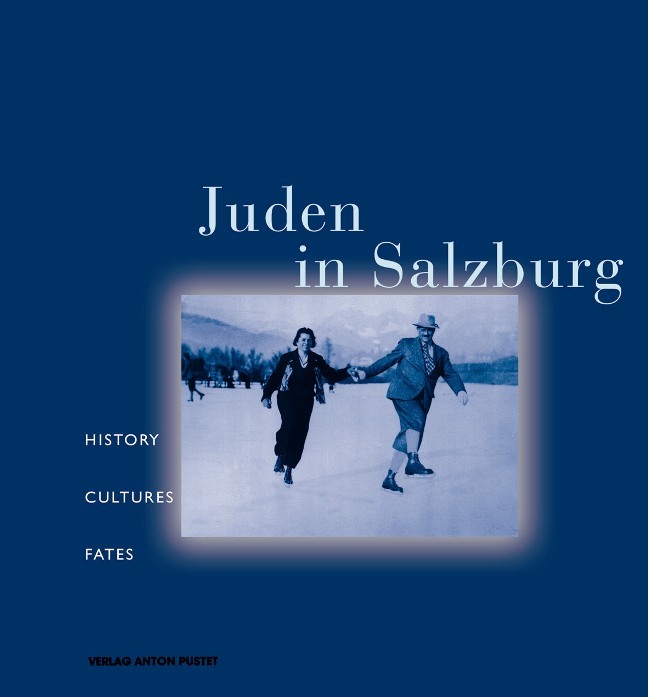Salzburg hat innerhalb der österreichischen Bundesländer die weitaus größte Dichte an Vier-Hauben-Restaurants. Eines dieser drei Spitzenlokale befindet sich im Schloss Prielau bei Zell am See – wer würde (oder möchte) bei einem von Jörg Wörther gezauberten Diner ahnen, dass auch diese Räumlichkeiten ihren Anteil an der Unrechtspolitik des „Dritten Reichs“ haben? Albert Lichtblau führt in „Juden in Salzburg“ das Schloss Prielau als ein Beispiel der „Arisierungen“ in Salzburg an: Der rechtmäßigen Besitzerin, der Witwe Hugo von Hofmannsthals, wurde 1942 die Staatsbürgerschaft entzogen, das Schloss fiel an den „Reichsgau Salzburg“, dieser verkaufte es an den „führenden Monumental-Bildhauer des Deutschen Reichs, Josef Thorak“. Leider erfährt man nichts über die Besitzverhältnisse nach 1945. Natürlich ist die Pustet-Publikation als Ausstellungskatalog konzipiert und kenntlich, alle Texte sind zweisprachig, deutsch und englisch, wiedergegeben – aber sie ist auch ein schön gestaltetes Buch ohne enervierende Inventarlisten und eine spannende und kompakte Einführung in das Thema Juden und Salzburg. Das jüdische Schicksal und der Antisemitismus lassen sich ja nicht zuletzt durch eine solche eindrückliche „Geschichte im Kleinen“ besser verstehen. Auch wenn man in der „Provinz“ das Phänomen des „Antisemitismus ohne Juden“ zu gewärtigen hat. In Salzburg wiesen nur die Stadt Salzburg sowie Bad Gastein einen nennenswerten jüdischen Bevölkerungsanteil auf. Und dieser war ebenfalls äußerst gering, in Salzburg-Stadt zählte die jüdische Minderheit, wie die Herausgeberin Helga Embacher anführt, nie mehr als 0,1 % der Bevölkerung.
Nicht nur die geringe Zahl jüdischer MitbürgerInnen war (und ist) ein Charakteristikum Salzburgs, auch die geringe Zeitdauer, während der hier Juden leben konnten. Im Mittelalter spätestens seit dem 11. Jahrhundert in Salzburg ansässig, standen die Juden stets „in persönlicher Abhängigkeit vom Erzbischof“ (Heinz Dopsch) – und dessen Finanzgebahrung. Pogromen 1404 folgten massive Verfolgungen, 1498 kam es zur endgültigen Vertreibung. „Die Stadt Salzburg aber ließ durch den berühmten Bildhauer Hans Valkenauer das Spottbild einer Judensau anfertigen“ (Dopsch), es hing bis 1785. Erst 1867, mit dem Erlass des Staatsgrundgesetzes, konnte sich wieder ein Jude in Salzburg niederlassen. Aber der Liberalismus hatte hier wenig Boden, dem Salzburger Bürgertum „wurde ein besonderer Hang zum Deutschnationalismus nachgesagt“, die „Blütezeit der jüdischen Gemeinde dauerte kaum ein Menschenleben“ (Embacher). Einer der wichtigsten jüdischen Geschäftsleute war Ignaz Glaser, der eine Glasfabrik in Bürmoos zur Blüte brachte (Georg Rendl setzte ihm mit dem Roman „Die Glasbläser von Bürmoos“ ein literarisches Denkmal).
Salzburg war unter den Nationalsozialisten besonders eifrig – am 12. November 1938 erklärte sich die Stadt „judenrein“. So war es umso erstaunlicher, dass nach der Shoah wieder eine jüdische Gemeinde in Salzburg entstand. 2001 zählte sie 80 Mitglieder. Eines ihrer bekanntesten Mitglieder ist der junge Schriftsteller Vladimir Vertlib, dessen Beitrag „Jude, wie interessant!“ den Schlusspunkt des Buches setzt. Vertlib schreibt über seine persönlichen Erfahrungen als Jude in Salzburg. Als er vor knapp zehn Jahren von Wien nach Salzburg gezogen ist, habe man ihn bemitleidet ob des ihm „bevorstehenden traurigen Schicksals“, in die Provinz zu ziehen. Und tatsächlich lernt er den Salzburger Antisemitismus als provinziell kennen, er unterscheide sich von der Wiener Ausprägung, der „Hinterfotzigkeit“, durch seine Direktheit, die manchmal geradezu lächerliche Züge annehme, so dass „man als Betroffener eher amüsiert als verletzt ist“. In erster Linie sei ihm Salzburg jedoch ein Ort der Arbeit, nach seinen Wanderjahren ein „neutrales Territorium“. Ein wohltuender Pragmatismus inmitten einer klischeeüberfrachteten Stadt.
Vertlib weist auch darauf hin, dass Salzburg wenig Wert darauf legt, von seinen „großen Söhnen“ auch die jüdischen in Ehre zu halten: neben Mozart scheint kein Platz mehr für Stefan Zweig oder Max Reinhardt zu sein, der „Geschmack der Vergänglichkeit“ (ein Ausdruck Max Reinhardts), der dem sommerlichen Kulturleben Salzburgs in der Zwischenkriegszeit anhaftete, ist noch keinem Geschmack der Beständigkeit gewichen. Der Ausdruck Reinhardts wurde zum treffenden Titel der Sammlung eines Dutzend Aufsätze, die sich der jüdischen Sommerfrische in Salzburg widmen. Auch hier gilt das oben Konstatierte: In der exemplarischen Nahaufnahme verliert der Antisemitismus seine Abstraktheit, wird zu einem „Nachbarn“. Christian Strasser geht ihm am Wallersee nach, Laurenz Krisch und Helga Embacher im Gasteiner Tal, Albert Lichtblau nimmt St. Gilgen unter die Lupe. Und einen gewichtigen Teil der Untersuchungen nehmen natürlich die Salzburger Festspiele ein (Regina Thumser etwa beschäftigt sich mit den jüdischen Künstlern bei den Festspielen).
Die Umgebung von Schloss Fuschl wird derzeit zu einem luxuriösen Wellness-Komplex umgebaut, im Schlossrestaurant genießt man die Kreationen einer Zwei-Hauben-Küche. Aber auch hier steckt die unheilvolle nationalsozialistische Geschichte im Gemäuer, wie das Gourmet-Schloss bei Zell am See wurde Schloss Fuschl zum NS-Beutegut. Und das noch schneller als das Hofmannsthal’sche Anwesen, wie Jutta Hangler in ihrem penibel recherchierten Beitrag ausführt, schließlich war Hitlers Außenminister an dem repräsentativen Gebäude interessiert. 1939 beschied die Gestapo die „Vermögensentziehung zu Lasten“ der Familie Remiz, der ehemalige Schlossherr, Gustav Remiz, wurde als Anhänger der Monarchie, als Renitenter in Dachau ermordet. Es ist auch Hanglers Verdienst, die Vermögensverhältnisse nach 1945 genau recherchiert zu haben – es überrascht nicht, dass sich hier Bund und Land nicht als große „Rücksteller“ hervortaten. Der Herausgeber Robert Kriechbaumer umreißt in seinem einleitenden Beitrag das thematische Feld und konzentriert sich dabei auf die Landeshauptstadt. Hugo von Hofmannsthal und besonders Max Reinhardt mit den berühmten Empfängen auf seinem Schloss Leopoldskron waren die größten Zielscheiben für nazistische Anfeindungen, Antisemitismus sei eine „permanente Wirklichkeit der Festspiele“ gewesen. In seinen oft überlangen Zitaten ruft Kriechbaumer natürlich auch Stefan Zweig in den Zeugenstand, da er das jedoch weitgehend unreflektiert tut, eignet er sich damit auch das Zweig’sche Pathos etwa der „Welt von Gestern“ an. Leider bleibt es auch bei der Kritik Karl Kraus‘ an den Festspielen nur beim Zitat, gerade hier wäre die Herstellung eines Konnex wichtig gewesen. Kriechbaumer scheint es um eine Art atmosphärischer Einleitung zu gehen, die – von obigen Ausnahmen abgesehen – auch weitgehend gelingt, mitunter geht aber der Metaphernhund mit Kriechbaumer durch (die „antisemitische Propaganda erhob ihr Haupt“, ein „Meer provinzieller Verengung“).
Von diesen Kleinigkeiten abgesehen muss man allerdings dem Herausgeber gratulieren, es ist ihm gelungen, durchgehend exzellente, fundierte Beiträge zu versammeln und in ein kompaktes, anregendes Buch zu verwandeln. Wie Günter Fellner, um noch einen Beitrag stellvertretend zu nennen, die beiden Phänomene Antisemitismus und Fremdenverkehr auf der Höhe der wissenschaftlichen Diskussion zusammenbringt, ohne in überdeterminierten, szientifischen Jargon zu verfallen, ist außerordentlich spannend zu lesen.
Beide Publikationen führen erneut deutlich vor Augen, wie auffällig spät in Salzburg (in Österreich) die Aufarbeitung unserer unmittelbaren Vergangenheit einsetzte und teilweise erst jetzt zu wichtigen (vorläufigen) Ergebnissen kommt. Diese sind zu einem nicht geringen Teil den Initiativen rund um die Historikerkommission zu danken. Die Publikationen führen in ihrer Fundiertheit aber auch vor Augen, wie viele Desiderate noch bleiben. Hoffentlich meint das offizielle Salzburg/Österreich nicht, mit den Aktivitäten der Historikerkommission und den ersten Entschädigungen seine Schuldigkeit getan zu haben.