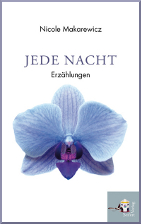Die Überschriften der dreißig Erzählungen deuten Alltägliches an, kommen ganz harmlos daher. „Das erste Mal“, „Im Spiegel“, „Vergissmeinnicht“. Was dahintersteckt: Eine Liebesnacht nach Operation und Chemotherapie; Einer, der meint, einen „Tod durch Verfettung“ zu sterben, aber „extrem untergewichtig, vermutlich magersüchtig“ ins Koma abtaucht; Eine Frau, der der Ehemann verloren geht und die nun in ihrem kleinen Dorf für „Schenkelklopfer, Rippenstöße und Witze gut“ ist.
Diese Sammlung des Nachtseitigen wirkt, als hätte die Autorin aus den Medien Fälle gesammelt, die Potenzial zum Schock haben. Makarewicz ist auf den Effekt aus. Knapp, mit kurzen Sätzen, einfachen Dialogen, inneren Monologen und erlebter Rede bringt sie die Texte in Stellung. Man fragt sich freilich wozu? Sicherlich gibt es Menschen, für die der Schrecken, zumindest der fiktive, eine notwendige Ingredienz ihres Lebens ist, um der Fadesse des Alltags zu entrinnen. Zu diesen Menschen gehörten vielleicht auch die Mitglieder der Jury der „12. Münchener Menulesung 2009“ und des „Forum Land Literaturpreises 2009“, die jeweils eine Erzählung dieses Bandes ausgezeichnet haben.
Es ist charakteristisch für viele Kurzgeschichten, dass die Personendarstellung typisierend ist: „Schon immer war er der Herr im Haus. Sein Wort war Gesetz, niemand wagte sich ihm zu widersetzen. Die Mutter, schwach, ausgelaugt, frustriert, verdammte sich selbst zur Lethargie, um den Frieden in der Familie zu wahren. Sie fügte sich.“ Da ist kein Platz zwischen Schwarz und Weiß. Da gibt es keine Grautöne. Und es stimmt auch, wenn der Klappentext die Faszination als „halb beklommen, halb voyeuristisch“ benennt.
Orte der Handlung sind teils die Großstadt und teils ländliche Gegenden. Im „Falter“ hat Nicole Makarewicz den Wiener als „schicksalsergeben und morbide“ bezeichnet. Und dies sei der „Nährboden für ihre Geschichten, die oft eine überraschende, abartige Wendung nehmen“.
Ihre Schilderungen des Ländlichen wirken wie holzschnittartige Ausrisse aus Innerhofers „Schöne Tage“. Es gibt immer das Gleichzeitige des Ungleichzeitigen.
Aber brauchen wir so viel fünfziger Jahre des 20. am Beginn des 21. Jahrhunderts?